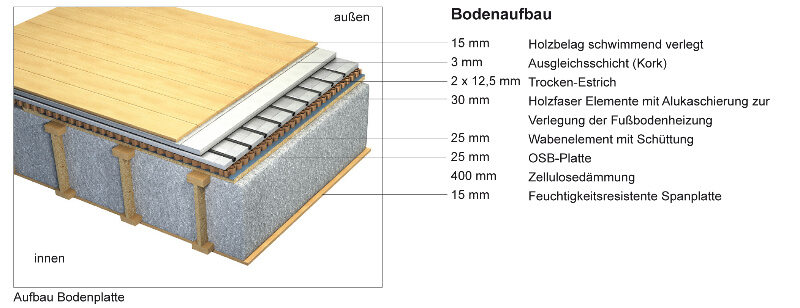Interview: Elke Kuehnle
Herr Professor Sobek, sie fordern seit 1992, dass Gebäude extrem effizient, voll rezyklierbar und mit geringem Ressourcenverbrauch gebaut werden.
Sobek: Viele meiner Kollegen schüttelten damals den Kopf und sagten, dass sie „für viele Jahre, ja für die Ewigkeit“ bauen würden. Aber wenn wir uns die gebaute Umwelt anschauen, stellen wir schnell fest, dass das Wenigste die Jahrhunderte überdauert. Vieles wird abgerissen, weil die Gebäude nicht gelungen waren, weil sich die Anforderungen der Nutzer veränderten, weil sich die Standards verschoben. Es ist zu kurz gedacht wenn man sagt, dass es für eine nachhaltige Architektur ausreichen würde so zu bauen, dass die Gebäude lange stehen bleiben. Wir können und dürfen nicht automatisch davon ausgehen, dass die Menschen von morgen das, was wir heute bauen, richtig und schön finden werden. Und: Egal, wie lange ein Gebäude steht, irgendwann muss es doch umgebaut oder gänzlich rückgebaut werden. Spätestens dann stellt sich die Frage nach dem Recycling. Die Grundlagen für eine vernünftige Rezyklierbarkeit legt man in der Planung und wir müssen endlich damit anfangen.
Mir war bereits während meines Studiums, das ich ein Jahr nach der ersten Ölkrise 1973 begann, klargeworden, dass wir einem globalen Problem von offensichtlich unglaublichem Ausmaß entgegeneilen. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Ressourcen und Energie erhöhte sich kontinuierlich, das Müllaufkommen und die Zerstörung der Umwelt nahmen immer bedrohlichere Ausmaße an. Gleichzeitig standen wir am Beginn einer Bevölkerungsexplosion, welche die genannten Phänomene nochmals dramatisch verstärken würde. Das alles war bekannt. Die Politik, ein großer Teil der Wissenschaft und viele Bürger haben dies alles aber – zeitweise bis heute – ignoriert. Ich wollte dies nicht und habe begonnen, an Veränderungen und Entwicklungen zu arbeiten, welche das Bauwesen, das einen erheblichen Anteil an den vorherzusehenden Entwicklungen hatte und haben wird, verändert.
Was haben Sie getan, um die Entwicklung voranzutreiben?
Im Jahr 2007 habe ich zusammen mit anderen Mitstreitern die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) gegründet. Diese ist eine der weltweit führenden Initiativen für die Definition, für das Messbarmachen von Nachhaltigkeit in der gebauten Umwelt. Gründung und Aufbau dieser Organisation haben mich sehr viel Lebenszeit gekostet – ich denke aber, dass es sich gelohnt hat. Ich habe des Weiteren zusammen mit dem damaligen Stuttgarter Oberbürgermeister Professor Wolfgang Schuster das Stuttgart Institute of Sustainability (SIS) gegründet. Diese eher regionale, industriegestützte Initiative untersucht, mit welchen Methoden und Bautechniken wir die von der DGNB formulierten Ziele überhaupt erreichen können. An meinem Institut ILEK wird seit Jahren intensiv an den genannten Themen geforscht. Erfreulicherweise sind viele meiner ehemaligen Mitarbeiter und Doktoranten heute selbst Professoren, so dass aus diesem Kreis ein großer Multiplikatoreneffekt entsteht. So bin ich zuversichtlich, dass die Dinge jetzt befördert werden.
Trotzdem kennt man diese Bauweisen und Materialien heute noch kaum .
Nun, wir haben im kleinen Kreis angefangen. Doch mittlerweile erreichen wir Bauherren, Wissenschaftler, aber auch immer mehr Politiker weltweit. Die Dinge beginnen, sich zu ändern. Ich sehe dies mit Freude.
Wir haben, heißt es, eine Recyclingquote mineralischer Baustoffe von 85 Prozent. Die Rezyklate werden im Straßenbau verwendet.
Die Zahl mag stimmen, wir müssen jedoch hinter ihr folgendes sehen: Es handelt sich zumeist um ein klassisches Downcycling. Natürlich kann man aus Betonschutt beispielsweise Straßenunterbauten oder Lärmschutzwälle bauen. Aber irgendwann ist auch unser Bedarf an Lärmschutzwällen gedeckt. Und dann? Natürlich kann und, besser, sollte man Betonschutt als Zuschlagstoff für neuen Beton verwenden – allerdings darf dieser Betonschutt dann nicht verunreinigt sein, das heißt er darf beispielsweise keinerlei Reste von Anstrichen, Gipsputz, Dübel, etc. enthalten. Wir müssen also im Bauen Technologien entwickeln, bei denen wir die Dinge sortenrein auseinandernehmen können. Die wenigsten Menschen wissen, dass die Zementherstellung mehr Co²-Emissionen produziert, als der weltweite Luftverkehr.
Wie verhält es sich mit der Wiederverwendung nicht mineralischer Materialien, wie Kunststoffen, Kabeln oder Anstrichen?
Diese müssen natürlich ebenso kritisch hinterfragt werden. Lackierte Hölzer oder Pressspanplatten, die mit Kunstharzen verklebt sind, kann man nicht einfach auf den Kompost werfen. Irgendein vordergründig schlaues Gremium hat als Ersatzlösung den Begriff des „thermischen Recyclings“ eingeführt – ein unanständiger Begriff, denn er täuscht uns. Thermisches Recycling ist nichts anderes als das Verbrennen häufig wertvoller Rohstoffe. Zudem: Mit aufwändigen Filteranlagen kann man dabei zwar einen Großteil der Schadstoffe, die bei diesen Verbrennungsprozessen entstehen, herausfiltern – es wird aber dennoch Kohlendioxid erzeugt. Das sollten wir in Zeiten des rapiden Global Warming ja tunlichst vermeiden. Die in Wänden und Decken eingebauten Installationen sind häufig nicht mehr oder nur mit großem Aufwand entfernbar. Man denke nur an eingeputzte Elektroleitungen oder Wasserrohre, die zudem meist noch von Wärme- und/oder Schallisolierungen umgeben sind. Putzsysteme, die in der Regel mit einem Anstrichsystem einhergehen, sind häufig weder untereinander trennbar noch lassen sie sich von Beton- oder Ziegelflächen lösen. Für das Recycling oder eine Wiederverwendung für diese Gemische aus mineralischen, metallischen und Kunststoffbauteilen existiert bis heute keine Lösung. Es sei denn, man baut von vornherein ein rezyklierbares Haus mit abbaubaren und wiedernutzbaren Bauteilen.
Warum werden trotzdem kaum rezyklierbare Häuser gebaut?
Weil dies einige grundlegende Änderungen in der Planung und im Bauprozess erfordern würde und auch Marktverschiebungen nach sich zieht. Zunächst: Das Bauwesen weist einige, nennen wir es „interessante“ Phänomene auf. Eines davon ist die komplette Trennung von Planung und Produktion. Das gibt es sonst in keiner anderen Industrie – obwohl dies, streng genommen, kompletter Unfug ist. An dem aber alle Beteiligten festhalten. Architekten und Ingenieure planen etwas, was dann in einer sogenannten Ausschreibung dokumentiert wird. Die ausführenden Baufirmen bepreisen und übernehmen die Planung, verändern aber typischerweise umgehend Qualitäten, tauschen Baustoffe aus, bringen eigene Standards ein. Das, was am Ende als Gebäude dasteht, weicht immer wieder deutlich von der Planung ab. Und weil es eben einfacher ist, alles miteinander zu verkleben, werden recyclinggerecht geplante Teile immer wieder anders als geplant gebaut. Darüber hinaus fehlt es auf der Baustelle an einem grundlegenden Verständnis seitens der beteiligten Menschen. Recyclinggerechtes Bauen durchzusetzen erfordert also eine Veränderung des Planungs- und des Bauprozesses und es erfordert zudem Veränderungen in der Ausbildung von Planern wie Ausführenden.
Das zweite Phänomen: Ein Haus wird heute gebaut und erst nach vielen Jahren umgebaut oder abgerissen. Das bedeutet, dass der Schutt typischerweise eine halbe oder eine ganze Generation später anfällt. In unserer nahezu vollständig auf monetären Profit ausgerichteten Gesellschaft bedeutet dies, dass es den Menschen zumeist einfach egal ist, was später geschieht. Es betrifft sie ja nicht mehr. Bei einem Automobilkonzern ist das etwas anderes. Der läuft Gefahr, dass er das von ihm gebaute Auto nach 10 oder 15 Jahren zurück nehmen muss und damit dann für sein Recycling verantwortlich ist. Im Bauwesen sind die Zyklen länger und die Firmen kleiner. Und: Eine Rücknahmeverpflichtung gibt es im Bauwesen bisher nicht. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist von, je nach Land und Bauwerk, drei bis zehn Jahren, gibt es seitens der Planer und Ausführenden nahezu keine Verbindlichkeit gegenüber dem Produkt „Gebäude“ mehr. Will der Bauherr zum Beispiel sein Gebäude 20 Jahre nach Fertigstellung umbauen und stellt dabei fest, dass vieles überhaupt nicht dem entspricht, was ihm hinsichtlich Rezyklierbarkeit, Resilienz etc. zugesagt wurde, steht er mit dem Problem alleine da.
In der Solarindustrie, mit ebenfalls langen Produktlebenszyklen, wird das über die E-Schrott-WEEE-Richtlinie geregelt. Hersteller bilden schon bei in Verkehrbringung von Produkten verbindliche Rücklagen dafür. Wäre das ein Regelungsansatz für das Bauwesen?
Wenn wir im Bauwesen ein derartiges Prinzip verankern möchten, gilt es zu überlegen, wie wir das am sinnvollsten machen. Hinsichtlich einer Regelung, wie sie von Ihnen angesprochen wurde, sollte man vorher prüfen, ob das Bauwesen so eine Regelung überhaupt durchhält. Die meisten Baufirmen sind kleine mittelständische Unternehmen. Angesichts ihrer niedrigen Umsatzrenditen bezweifele ich, dass es überhaupt möglich ist, die erforderlichen Rücklagen zu bilden. Es müssten also innovative und branchenweite Regelungen gefunden werden. Denkbar wäre zum Beispiel, dass Bauherren in einen Rücklagenfond einzahlen. Wichtig wäre eine politisch abgesicherte Begleitmaßnahme, die eine Rücklagenbildung überhaupt erst ermöglicht. Die Bauindustrie muss hier eingebunden werden, aber man muss der Bauindustrie hierzu auch vernünftige Margen erlauben. Durch die aktuelle Ausschreibungs- und Vergabepraxis werden die Margen auf ein unerträglich niedriges Maß gedrückt. Dies führt zwangsläufig dazu, dass die Baufirmen nach Vertragsunterschrift sofort versuchen, über Nachträge dasjenige Geld hereinzuholen, das sie eigentlich im Angebot hätten einpreisen müssen – und es führt dazu, dass in der Ausführung immer wieder versucht wird, niedrigwertige Qualitäten einzusetzen. Wenn man einen Auftrag prinzipiell an den billigsten vergibt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man Niedrigwertiges bekommt. Die Schweizer sind klüger: Sie vergeben prinzipiell an den Zweitbilligsten – was zu einer wesentlich gesünderen Firmenstruktur führt.
Die EU verlangt, dass bis 2025 weniger Sondermüll produziert werden soll. Aber allein 2011 wurden rund 17 Millionen Kubikmeter Mineralwoll-Dämmstoff und etwa 15 Millionen Kubikmeter EPS-, PUR- und extrudierte Polystyrol-Dämmstoffe verbaut. Wie passt das zur Nachhaltigkeit im Bauwesen, zumal die EU ein „thermisches Recycling“ nicht mehr als Entsorgungslösung sieht.
Der Gesetzgeber hat viel zu lange auf das einzelne Gebäude fokussiert und sich dabei auch noch ausschließlich auf die Energieeinsparung im Gebäudebetrieb konzentriert. Luftdichtigkeit und Wärmedämmung waren und sind hier die großen Themen. Man hat nicht bedacht, welche Rohstoffe man zur Wärmedämmung heranziehen sollte, ob diese aus dem zur Neige gehenden Erdöl hergestellt werden, wie viel Energie man für ihre Produktion benötigt und wie man sie später wieder rezykliert, das heißt wie man sie in die Stoffkreisläufe zurückführt. Wir müssen zukünftig vieles anders machen, die Betrachtungshorizonte erweitern. Wir brauchen eine Dämmtechnik, die es ermöglicht, dass beispielsweise Polystyrol oder Polyurethan auch in 25 Jahren wieder sortenrein entnommen und für andere Zwecke verwendet werden können – wenn wir es denn schon nicht schaffen, in großem Umfang andere Materialien einzusetzen oder mit prinzipiell anderen Technologien weiterzukommen. Die Aktivhaustechnologie ist hier – nach meinem Dafürhalten – der einzigmögliche Ansatz.
Was also ist für eine erfolgreiche Energiewende und nachhaltige Bauwirtschaft erforderlich?
Wir brauchen eine konsequente, von der Gesellschaft mitgetragene Zielansage seitens der Politik. Diese könnte so lauten, dass ab einem bestimmten Jahr im Wohnungs- oder Bürobau nur noch ein bestimmter Energieverbrauch pro Kopf (das ist wichtig!) zulässig ist, der ausschließlich aus nicht-fossilen, nicht-nuklearen Energieträgern gedeckt werden darf. Eine solche Zielvorgabe ohne jedwedes Vorschreiben von spezifischen Maßnahmen zur Zielerreichung würde einen unglaublichen Innovationsschub auslösen. Aber – es müsste eben endlich einmal klar gesagt werden. Der sorgfältige Umgang mit unseren Ressourcen muss zum zentralen, gemeinsamen Ziel unserer Gesellschaft werden. Eine solche Grundhaltung würde innerhalb weniger Jahre enorme Veränderungen bewirken.
Welche Bedeutung haben Fügetechniken für das nachhaltige Bauen?
Wenn wir kleben, müssen wir dies so tun, dass man den Kleber später wieder leicht auflösen kann. Das ist nicht immer einfach realisierbar, man könnte aber beispielsweise im Innenausbau viel mehr wasserlösliche Kleber einsetzen. Ansonsten muss man eben das Spektrum der zur Anwendung kommenden Fügetechniken erweitern: Man kann auch mit Klettverschlüssen arbeiten, mit Verhakungen, magnetischen Befestigungen, und so weiter. Man kann nach wie vor auch schrauben und nageln – aber eben so, dass die Verbindungsstellen später leicht zugänglich sind. Die Nägel dürfen also nicht unter dem Putz liegen, da sie sonst keiner wiederfindet. Nun kann man sagen: die paar Nägel. Doch jeden Tag werden allein Kunststoffdübel im zweistelligen Millionenbereich produziert und verbaut. Vor dem Hintergrund dieser Dimension wird schnell deutlich, dass es Sinn macht, auf die spätere Ausbaubarkeit zu achten. Was ich auf alle Fälle vermeide, sind großflächige Verbundwerkstoffe, die man später nicht mehr trennen kann.
Elke Kuehnle ist Journalistin und lebt in München.