
Von Danuta Schmidt und Roland Stimpel
Projekte und Publikationen zur urbanen Landwirtschaft erleben eine Blüte. Die Erwartungen sind hoch und vielfältig: Städter sollen ihre eigenen Nahrungsmittel erzeugen und ihre Kinder daran teilhaben lassen, Brachflächen sinnvoll nutzen, Natur-Erfahrungen machen, das Stadtklima verbessern sowie multi- und interkulturell agieren. Und das agrar-urbane Potenzial scheint immens. Selbst die 8-Millionen-Metropole London, weit dichter besiedelt als alle deutschen Städte, kann nach einer Berechnung des dortigen Büros Bohn & Viljoen Architects 30 Prozent des lokalen Obst- und Gemüsebedarfs decken. Das ist nach den Worten der österreichischen Agrarwissenschaftlerin Andrea Heistinger möglich, „ohne auch nur einen Park in ein Kohlfeld zu verwandeln“. Man müsse lediglich den „untergenutzten öffentliche Stadtraum in produktive Landflächen umwandeln“.
Für urbane Landwirtschaft gebe es zwei Flächentypen: zum einen Agrar- und Gartenland in der Nähe der Städte und in den zersiedelten Peripherien. Ihre Bewirtschaftung ist eher konventionell und professionell; Städter kommen nur gelegentlich zum Spaziergang oder zum Pflücken von Blumen oder Erdbeeren. Flächentyp zwei liegt mitten in der Stadt; der Stuttgarter Landschaftsarchitekt Frank Lohrberg nennt als typische Orte „begrünte Hinterhöfe und Brachen, Mieter- und Schrebergärten“. Hier ist zwar das Ernten und Verzehren willkommen und wird angestrebt – aber wichtiger als die essbaren Früchte sind die sozialen und stadtökologischen: Beschäftigung, Vernetzung, Integration und Bewusstseinsbildung. Dass der Schwerpunkt auf dem Sozialen liegt, zeigt zum Beispiel das deutsche Buch mit dem englischen Titel „Urban Gardening“. Herausgeberin ist die Soziologin Christa Müller; unter den Autoren dominieren die acht Sozialwissenschaftler. Nur halb so viele Landschaftsplaner und nur zwei Agrarwissenschaftler widmen sich dem scheinbaren Ernährungsthema.
Selbstversorger mit Integrationsauftrag
Kein Wunder, denn es geht laut Frank Lohrberg um einen „akteursorientierten Ansatz“ – um „urbane Landwirtschaft als soziale Strategie“. Und zwar eine, in der der reiche, seit Langem industrialisierte Norden der Welt vom ärmeren Süden lernen soll. Lohrberg: „In den Entwicklungsländern hat der akteursorientierte Ansatz schon länger Tradition.“ Arme Landflüchtlinge, die in die Stadt kommen, sollen dort ihr Essen selbst anbauen. Auch in Europa gab es das, etwa in den Gärten der Zechensiedlungen oder den frühen Laubenkolonien. Doch diese sind längst zugebaut oder zu Zier- und Vergnügungsgärten mutiert.
Städtische Landwirtschaft stand später für Not – etwa auf den Bildern vom Gemüseanbau im kahl geschlagenen Berliner Tiergarten 1945. Erst in den 1990er Jahren hat laut Lohrberg „die Sozialarbeit europäischer und amerikanischer Metropolen“ den Nahrungsmittelanbau wiederentdeckt. „Im Blick standen und stehen seither Bevölkerungsgruppen, die durch Migration und Prekariat geprägt sind.“ Von dort wanderte der Gedanke sozial aufwärts – bis ins Gemüsebeet am Weißen Haus, das die einstige Chicagoer Sozialarbeiterin Michelle Obama anlegte.
Heute sollen die Akteure nicht nur essen, was sie in der Stadt anpflanzen, sondern sich in der Stadtlandwirtschaft sinnvoll beschäftigen, Angehörige anderer sozialer Gruppen kennenlernen und damit die eigene Integration oder die ihrer Mit-Gärtner voranbringen. Sie sollen die Stadt beleben, Brachen verschönern – und sie sollen gleich doppelt das Klima schonen: erstens durch das Vermeiden langer Transportwege für Nahrungsmittel, zweitens durch lokale Abkühlung der sommerlichen Stadt dank ihrer unversiegelten Flächen. Lohrberg propagiert Stadtäcker und -beete auch zur Verhinderung „ungesunder Bebauungsdichten“.
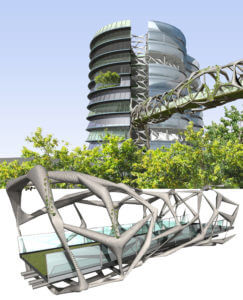
Urbane Landwirtschaft stellt neue Planungsfragen – inhaltliche wie prozessuale. Wo hört das selbstverwaltete Gärtnern in der Stadt auf und wo fängt der städtisch geplante Prozess an? Katrin Bohn, Architektin und Gastprofessorin für „Stadt und Ernährung“ an der TU Berlin: „Wir wollen als Freiraumplaner diese Initiativgründungen ja nicht unterdrücken.“ Derzeit arbeitet sie an einem Entwurf zu einer „Strategie Urbane Landwirtschaften“ für den Berliner Senat. Dazu gehören „eine gründliche Flächeninventur, die Erforschung des Bedarfes unter der örtlichen Bevölkerung und die marktwirtschaftlichen Möglichkeiten konkreter Projekte“.
Biokartoffel oder Bebauungsplan
In Wissenschaft und Praxis ist das Aufgabenfeld der Landschaftsplaner bisher nur grob umrissen. Almut Jirku, stellvertretende Vorsitzende des Bundes deutscher Landschaftsarchitekten: „Wir können in Masterplänen Bereiche für die urbane Landwirtschaft vorsehen, Flächen arrangieren und dafür bei den Landwirten vor Ort werben. Hinzu kommen kann die Moderatorenrolle für Transformationsprozesse und die Beratung bei der Umsetzung“. Auch hier geht es mehr um Kommunikation und Soziales als ums Entwerfen. Nur wenige Landschaftsarchitekten sind bisher auf das Thema spezialisiert – etwa Ines-Ulrike Rudolph in Berlin, hervorgetreten durch ihr Management des „Wriezener Freiraumlabors“ auf dem Gelände eines früheren Güterbahnhofs und inzwischen Projektmanagerin einer städtischen Gesellschaft für den Ex-Flughafen Tempelhof.
Über allen Ausführungs-Fragen steht eine grundsätzliche: Kann eigentlich urbane Landwirtschaft die immensen sozialen und ökologischen Erwartungen erfüllen, die auf ihr ruhen? Vielleicht ist das selbst angepflanzte Essen ja gar nicht so gesund, wenn der Boden verseucht ist und das Beet von Abgasen umnebelt wird. Die europäischen Großstädte und deren Peripherien bieten zahlreiche Bilder, die eher auf die Schwierigkeit des Gärtnerns in der City deuten: Feinstaub, fruchtlose Böden, Verschattung, Trockenheit. Aber man muss nur suchen, sagt Katrin Bohn, Architektin und Gastprofessorin für „Stadt und Ernährung“ an der TU Berlin: „Ein Landwirt würde einen Standort nach den gleichen Kriterien untersuchen wie der Architekt oder der Landschaftsarchitekt: Wie sind die Belichtung, die Windverhältnisse, die Bodenqualität, die Verschmutzungen? Und wie sehen die infrastrukturellen Bedingungen aus?“ In den Prinzessinnengärten am verkehrsbelasteten Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg entsteht zertifiziertes Bio-Gemüse. Demeter-Standards legen fest, wie weit eine Anbaufläche von der Straße entfernt sein muss, welches Saatgut und welche Erde verwendet werden darf.

In der allgemeinen Euphorie wird noch kaum die Frage diskutiert, was denn die städtische Landwirtschaft mit der Stadt macht. Klar ist: Wo diese sich ohnehin zurückzieht, kann das Gärtnern und Pflanzen Reste zusammenbinden und beleben. Nicht zufällig floriert es in Kommunen wie Dessau und Detroit. Doch was ist mit stabilen oder gar wachsenden Städten? Hier konkurriert das Beet mit dem Baufeld. Bleiben Orte im Stadtinneren dem Beet vorbehalten, geht der Bau nach allen Erfahrungen nach draußen. Und dann wird das Ganze urban wie ökologisch fragwürdig: Was die Städter sozial zusammenbinden soll, treibt sie räumlich auseinander. Ein oder zwei Transportwege pro Jahr für Apfel und Tomate sind kürzer, doch die täglichen Wege der Menschen werden länger. Intensiv genutzte Flächen, auf denen Tag und Nacht und rund ums Jahr viele Menschen agieren, wechseln sich ab mit verdünnten, auf denen von Frühjahr bis Herbst ab und zu jemand pflügt, sät, jätet und erntet. Teure urbane Infrastruktur wird hier wenig genutzt, zugleich muss sie anderswo zusätzlich geschaffen werden.
Wie das Ländliche die Stadt stört, so auch umgekehrt: Zum Nahrungsmittelanbau eignen sich Flächen am besten, die weder verschattet noch von Abgasen vernebelt sind, durch die nur wenige Wege führen und auf denen möglichst keine Städter herumtrampeln und -müllen. Wo eine stadtnahe oder städtische Fläche allzu gut erschlossen ist und viel intensiver genutzt werden könnte, da ist die Landwirtschaft ökonomisch latent bedroht und daher nur bedingt entwicklungsfähig. Dauerhaft an ihr kann nur das Temporäre sein – und das Prinzip Wanderacker, der Umzug von einer zeitweiligen Brache auf die nächste.
Städte waren fast in ihrer ganzen Historie die Gegenmodelle zur ländlichen Welt: arbeitsteilig und beruflich spezialisiert, dicht bebaut und aufwendig erschlossen. Stadtluft machte auch deshalb sprichwörtlich frei, weil sie vom Zwang des Subsistenz-Anbaus befreite. Auch heute tragen mehr Städter und Städterinnen ihre Fingernägel lieber sauber, lang und lackiert, als sich nach erdigem Schwarz unter den Nägeln zu sehnen. Im 20. Jahrhundert startete nach dem Schock der Industrialisierung das Experiment „Stadtlandschaft“. Es ist in den Suburbs der USA und den Zwischenstädten Europas gescheitert. Kann die urbane Landwirtschaft des 21. Jahrhunderts die Gegensätzlichkeit von Stadt und Land aus der Welt schaffen?
War dieser Artikel hilfreich?
Weitere Artikel zu:



Urbane Landwirtschaft ist mehr als nur multikulturelles Engagement, sie kann verschiedene Zielgruppen binden und nachhaltig innerstädtische Brachen bzw. Grünflächen einer Nutzung zuführen. Zielgruppen sind können unter anderem Werkstätten für Menschen mit Behinderung sein, die die Bewirtschaftung der Flächen, z.B. mit Gemüse- und Obstanbau, übernehmen, Einnahmen aus dem lokalen Vertrieb erzielen und letztendlich auch als Wirtschaftsfaktor an einem langfristigen Betrieb der Standorte interessiert sind (Grüne Werkstatt). Diese Form der Bewirtschaftung, z.B. mit dem Anspruch ökologischen Landbaus und damit einem hohen Anteil manueller Arbeit, trägt zur Integration der Zielgruppe in den Stadtraum bei, bindet lokal und regional engagierte Partner, wie Landwirte und Einzelhändler, und reduziert die Unterhaltungskosten seitens der Eigentümer. Als Gegenargument wird in der Diskussion gern der Flächendruck auf die landwirtschaftlichen Flächen genannt, wir sehen jedoch urbane Landwirtschaft als Instrument der Stadtplanung, die sowohl den Leerstand als auch die Ausdünnung innerstädtischer Wirtschaft, vor allem in kleineren und mittleren Städten, handhaben muss. Die Flächen für diese Ansätze finden sich vor allem in den Randlagen dieser Innenstädte. Basis jeglichen Konzeptes ist jedoch eine klare Zielstellung und Strategie zur Etablierung urbaner Landwirtschaft seitens der Stadtverwaltung und der Politik.