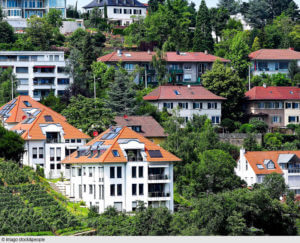Meteorologen sagen als Folge des Klimawandels voraus, dass künftig Hitzewellen, Dürren und Extremwetter mit Starkregen das städtische Klima prägen. Die Folgen seien Überschwemmungen und eine überlastete technische Infrastruktur sowie überhitzte Innenstädte mit schlechter Durchlüftung und schlechter Luftqualität. Dieser Hitzestress wirkt sich auf die Arbeitsqualität, aber auch auf die menschliche Gesundheit aus, je nach Verletzbarkeit der Städte. Daraus resultierend, wird eine Strategie der Klimaanpassung nötig. Zu ihr gehören die Anpassung an Extremwetter, etwa durch ausreichende Überflutungsfläche, ein besseres Mikroklima in der Stadt, vor allem durch mehr Grün und Wasser sowie geschützte oder neu geschaffene Frischluftschneisen.
Hier zeichnen sich jedoch Konflikte mit anderen Zielen ab: „Innen- vor Außenentwicklung“ und „nachhaltige Stadtentwicklung“ – diese Grundsätze der Leipzig-Charta von 2007 sind im Planungsrecht verankert und werden durch das Leitbild der kompakten Stadt abgebildet. Dieses Leitbild entspricht auch den Zielen des Klimaschutzes im Hinblick auf kurze Wege und Kompaktheit.
In der Stadtforschung wird nun debattiert, ob bestehende Leitbilder um Aspekte der Klimaanpassung ergänzt werden können oder ob etwa neue Leitbilder wie die „resiliente Stadt“ erforderlich sind, die beide Ziele optimiert. Der kontrovers diskutierte Begriff „Resilienz“ stammt ursprünglich aus der Ökologie und beschreibt die Fähigkeit eines (ökologischen) Systems, nach einer Störung wieder zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Hinsichtlich der Klimaanpassung können unter anderem folgende Resilienzkriterien herangezogen werden:
Welches städtebauliche Leitbild ist für Klimaschutz und Klimaanpassung am besten geeignet? Dies wurde im Forschungsprojekt „Klimaanpassung in der Region Stuttgart“ untersucht, das vom Bundesministerium für Umwelt und Bau gefördert wurde. Im Projekt wurden fünf Leitbilder des 20. und 21. Jahrhunderts hinsichtlich der Klimaanpassung überprüft: die kompakte Stadt, die entdichtete und perforierte Stadt, die gegliederte und aufgelockerte Stadt, die Netzstadt und schließlich die Punkt-axiale Stadt mit kompakten Kernen entlang von Entwicklungsachsen, wie sie etwa Fritz Schumacher in seinem Hamburger Achsenkonzept propagierte.
Dabei stellte sich heraus, dass keines der bestehenden Leitbilder vollständig geeignet ist, um die beschriebenen Widersprüche aufzulösen. Die Leitbilder, die mit dem Resilienzkonzept am ehesten übereinstimmen, sind die „kompakte Stadt“ und die „Punkt-axiale Stadt“. Die kompakte Stadt hat eine hohe Effizienz und einen geringen Flächenverbrauch – doch aufgrund der hohen Dichte mangelt es an Grünflächen. Diese können jedoch beispielsweise in Form von Straßengrün und Dachbegrünung ergänzt werden. Die Punkt-axiale Stadt ist positiv bewertet aufgrund der robusten Infrastruktur, der Siedlungskonzentration an Achsen und der Sicherung von Grünschneisen. Sie ist schwächer hinsichtlich der Redundanz, da sie in den Zentren entlang der Achsen störanfälliger ist. Schlechtere Bewertungen erhielten die Leitbilder „entdichtete Stadt“, „gegliederte und aufgelockerte Stadt“ sowie die „Netzstadt“: Hier sind die Wege länger, die Autoabhängigkeit ist größer, die Infrastruktur ist aufwendiger, weitmaschiger und schlechter ausgelastet, und aufgrund der eher suburbanen Siedlungsstruktur ist der Flächenverbrauch größer.
Die Ziele der kompakten oder der Punkt-axialen Stadt entsprechen also bereits in vielen Aspekten den Anforderungen der Klimaanpassung; sie müssen nicht grundsätzlich infrage gestellt werden. Von daher muss kein neues übergeordnetes Leitbild der „resilienten Stadt“ eingeführt werden – die Aspekte der Resilienz einschließlich Robustheit und Redundanz sind aber künftig stärker als zusätzliche Kriterien in den etablierten Leitbildern zu berücksichtigen.
Das könnte Sie auch interessieren
Klima-Anpassung und Stadtentwicklung
Viele Städte haben in den letzten Jahren bereits umfassende Klimaschutzkonzepte erstellt; diese werden im Sinne einer „Energienutzungsplanung“ oder „Klimaleitplanung“ immer stärker mit der Stadtentwicklungsplanung und der Bauleitplanung verknüpft. Aufgrund des Klimawandels besteht die Notwendigkeit, zusätzlich auch gesamtstädtische und teilräumliche Fachpläne zur Klimaanpassung zu erstellen – dazu gibt es bislang nur wenige Erfahrungen. Die meisten bisherigen Klimaanpassungskonzepte basieren auf Landschaftsplänen und der damit verknüpften Umweltprüfung, da auch dort klimatische Aspekte erfasst werden. Diese Konzepte sollten künftig stärker mit Aspekten der Stadtentwicklung und des Städtebaus verzahnt werden.
In der Bauleitplanung gibt es seit der Klimaschutz-Novelle des BauGB von 2011 zahlreiche Optionen für die Festsetzung von klimarelevanten Maßnahmen (vgl. § 1 (5) sowie § 1a (5) BauGB). Die Ziele, wie geringe Verletzbarkeit, Schutz von Luftleitbahnen und stärkere Resilienz, sollten aber mit städtebaulichen Aspekten, wie Dichte, Mischung und Gestaltqualität, abgewogen werden, Zielkonflikte müssen gelöst werden. Architekten und Stadtplaner sollten hier die Kooperation mit Klimatologen und Landschaftsplanern suchen, um negative städtebauliche Effekte, wie eine stärkere Zersiedelung oder geringere Nachverdichtung, zu vermeiden.
Esslingen: Ein Beispiel mit Zielkonflikten
Die von Wirtschafts- und Einwohnerwachstum geprägte Region Stuttgart ist aufgrund der bewegten Topografie mit schmalen Tälern und umgebenden Hanglagen stark vom Klimawandel betroffen. Da auch wenig Wind weht, sind die Städte schlecht durchlüftet und stark hitzebelastet. Ein 2008 erstellter Klimaatlas für die Region macht deutlich, dass aufgrund des Klimawandels künftig vermehrt mit Hitzewellen, Überschwemmungen, Niedrigwasserständen, Dürren, Stürmen und Gewittern zu rechnen ist.
Stuttgarts Nachbarstadt Esslingen liegt im Neckartal mit Hanglagen nahe der Innenstadt. Klimatisch weist Esslingen ähnliche Merkmale wie Stuttgart auf: Im Sommer staut sich die Hitze in der Innenstadt, da das Einströmen frischer Luft aus dem Umland durch bauliche Barrieren eingeschränkt ist. Die Sicherung und der Ausbau von Frischluftschneisen sind deshalb wesentlich für die Klimaanpassungsstrategie Esslingens.
Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, die mit einer Stadtentwicklungsstrategie und einem intensiven Beteiligungsverfahren verknüpft ist, wurde ein neues räumliches Leitbild erstellt: eine kompakte Stadt mit Nachverdichtung und Neubau an Verkehrsknotenpunkten, aber auch eine Entdichtung an den Frischluftschneisen. Vom Büro Planung und Umwelt Stuttgart wird derzeit ein Fachplan zur Klimaanpassung für den Flächennutzungsplan erarbeitet.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden auch neue Planzeichen für den Flächennutzungsplan entwickelt. Sie markieren Ziele wie die Sicherung von Luftleitbahnen, eine bessere Durchlüftung, die Vermeidung von Kaltluftbarrierewirkungen sowie die punktuelle Entdichtung. Zudem werden Flächen zur Sicherung durchgrünter Wohngebiete dargestellt, bei Nachverdichtung sind siedlungsklimatische Belange zu berücksichtigen.
In Esslingen wird auf Leitbild-Ebene der Zielkonflikt deutlich: Zum einen sollen kompakte Baustrukturen erhalten und nachverdichtet werden, zum anderen sollen Frischluftbahnen gesichert und teilweise entdichtet werden. Wesentliche Frischluftleitbahnen befinden sich entlang der Täler, welche die frische Luft des Umlandes in die Stadt leiten sollen. Diese Täler sind allerdings weitgehend bebaut, wodurch eine Barrierewirkung entsteht. Eine Entdichtung kann also nur punktuell erfolgen, zugleich sind die Flächen für Innenentwicklung begrenzt.
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden diese Themen kontrovers diskutiert, was schließlich den gesamten Planungsprozess infrage stellte. Die Abwägung der grundsätzlichen Zielkonflikte im Rahmen der Fortschreibung des FNP ist noch nicht abgeschlossen.
Folgerungen: Stadtstrukturen bewahren – Konflikte innovativ lösen
Klimaanpassungsmaßnahmen müssen nicht zwangsläufig dazu führen, Ziele der Nachverdichtung oder Kompaktheit zu hinterfragen. Dennoch müssen Grenzen der Nachverdichtungen stärker beachtet werden, zum Beispiel durch den Schutz von Frischluftschneisen, Hitzeinseln und Überschwemmungsgebieten. Im Rahmen von Klimaleitplänen sollten die Ziele der Klimaanpassung und des Klimaschutzes in einer nachhaltigen Stadtentwicklungsstrategie abgewogen werden. Letztlich geht es um eine verbesserte Kooperation zwischen Klimatologen, Landschaftsplanern, Stadtplanern und Architekten, um die zukünftige Stadt lebenswert zu gestalten, ohne gleichzeitig die bestehenden Stadtstrukturen völlig infrage zu stellen.
In Esslingen wird deutlich, dass bei einer engen topografischen Situation und starkem Wachstumsdruck die Zielkonflikte von Nachverdichtung versus Sicherung von Luftleitbahnen sehr gewichtig werden und im örtlichen Einzelfall zu lösen sind. Hier sind innovative Maßnahmen gefragt: kleinräumige Durchgrünung („grüne Stadt“), Wasser („blaue Stadt“), helle Oberflächen („weiße Stadt“) und ausreichende Verschattungsflächen („graue Stadt“).
Josefine Korbel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, Detlef Kurth ist Professor an der Hochschule für Technik Stuttgart, beide im Zentrum für Nachhaltige Stadtentwicklung
Links:
Download des Forschungsberichts
https://www.hft-stuttgart.de/Forschung/Projekte/Projekt110.html/de
Präsentation des Projekts
http://www.ifr-ev.de/fileadmin/pdf/Jahrestagungen/2015/Vortrag_JT_2015_Kurth.pdf
Quellen
Birkmann, Jörn; Schanze, Jochen; Müller, Peter; Stock, Manfred (Hg.) (2012): Anpassung an den Klimawandel durch räumliche Planung. Grundlagen, Strategien, Instrumente, E-Paper der ARL, Nr. 13. Online verfügbar unter: http://shop.arl-net. de/media/direct/pdf/e-paper_der_arl_nr13.pdf (letzter Zugriff: 29.04.2015)
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR); Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVBS) (Hg.) (2009a): Klimawandelgerechte Stadtentwicklung, Rolle der bestehenden städtebaulichen Leitbilder und Instrumente, BBSR-Online-Publikation 24/09
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR); Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVBS) (Hg.) (2009b): Klimawandelgerechte Stadtentwicklung, Ursachen und Folgen des Klimawandels durch urbane Konzepte begegnen, BBSR-Online-Publikation 22/0
Bundesregierung (2008): Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Online verfügbar unter: www.bmu.de/files/ pdfs/allgemein/application/pdf/das_gesamt_bf.pdf (letzter Zugriff: 27.05.2014)
Fluhrer, Daniel (2015): Alte Leitbilder, neue Herausforderungen und irritierte Bürger. In: Bohne, Reiner u.a. (Hg): Leitbilder. SRL-Schriftenreihe Band 57. Berlin, S. 105-112
Godschalk, David R. 2003: Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities. Natural Hazards Review, Jg. 4, H. 3, S. 136 – 143. http://www.tc.umn.edu/~blume013/Godschalk_urb_haz_mit2003.pdf, Zugriff 20.02.2014
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2007): Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. In: Klimaänderung 2007: Auswirkungen, Anpassung, Verwundbarkeiten. Beitrag der Arbeitsgruppe II zum Vierten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderung (IPCC), M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, C.E. Hanson and P.J. van der Linden, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK. Deutsche Übersetzung durch ProClim-, österreichisches österreichisches Umweltbundesamt, deutsche IPCC-Koordinationsstelle. Bern/Wien/Berlin
IPCC (2014): Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland
Kaltenbrunner, Robert (2013): Mobilisierung gesellschaftlicher Bewegungsenergien. Von der Nachhaltigkeit zur Resilienz -und retour? In: BBSR (Hg.) Resilienz, Information zur Raumentwicklung 4.2013. Stuttgart, S. 287-295
Knieling, Jörg ; Kretschmann, Nancy ; Kunert, Lisa ; Zimmermann, Thomas (2012): Klimawandel und Siedlungsstruktur: Anpassungspotenzial von Leitbildern und Konzepten, In: neopolis working paper no. 12, urban and regional studies, Hafen-City Universität Hamburg
Umweltbundesamt (Hg.) (2013): Handbuch zur guten Praxis der Anpassung an den Klimawandel. Dessau-Roßlau
Verband Region Stuttgart (2008): Klimaatlas Region Stuttgart, Stuttgart. Online verfügbar unter: http://www.stadtklima
War dieser Artikel hilfreich?
Danke für Ihr Feedback!