
Dieses Interview ist unter dem Titel „Du mit deinem tollen Umbau!“ im Deutschen Architektenblatt 05.2022 erschienen.
Interview: Brigitte Schultz
Das könnte Sie auch interessieren
Die Energie- und Rohstoffpreise gehen durch die Decke, zum Schutz des Planeten müssen wir Ressourcen sparen. Trotzdem wird viel „graue Energie“ abgerissen – unter anderem für vermeintlich schickere, „nachhaltige“ Neubauten. Wie kriegen wir diesen Knoten gelöst?
Reiner Nagel: Einerseits durch Informationen – deshalb haben wir eine neue Umbaukultur zum Schwerpunkt des neuen Baukulturberichts gemacht, mit viel Hintergrundwissen, guten Beispielen und Grafiken. Neben Zahlen und Fakten braucht es aber auch eine emotionale Ansprache. Im Bestand steckt ja nicht nur graue, also ressourcenbezogene Energie, sondern auch emotionale: die Seele, der Charakter der Häuser und ihre Geschichte. Das bietet großes Potenzial für eine weitere Entwicklung. Wir nennen es: von der grauen zur goldenen Energie.
Andrea Gebhard: Die Frage ist ja oft: Abreißen oder nicht? Um dies qualifiziert zu beantworten, braucht es eine gute Analyse. In meiner Funktion bei der Stadt München ist mir beispielsweise 2008 ein großes Gebäude mit genau dieser Frage angetragen worden, ein ehemaliges Rechenzentrum von Siemens Nixdorf. Nach einer umfangreichen Recherche war klar, dass das Gebäude viel Potenzial hat. Es gab dann einen Wettbewerb, den Sauerbruch Hutton gewonnen haben. Jetzt ist es eines der großartigen Gebäude am Mittleren Ring, das ein ganz anderes Gesicht und auch eine neue Seele bekommen hat – statt als Bauschutt zu enden.
Wie können wir die Potenziale des Bestands besser nutzen?
Andrea Gebhard: Damit solche Beispiele mehr werden, brauchen wir eine Umbauordnung. Die Vorschriften müssen so verändert werden, dass der Umbau gegenüber dem Neubau privilegiert wird. Das sind Dinge, die ich gerade intensiv als Präsidentin der BAK und als Vorsitzende des Beirats der Bundesstiftung Baukultur vorantreibe.
Reiner Nagel: Der Bestand hat es aus vielen Gründen schwerer: Brandschutz, Schallschutz, Schadstoffe, Flächeneffizienz und fehlende digitale Planunterlagen etwa. Jede dieser Anforderungen könnte man erleichtern, indem man zum Beispiel baurechtlich die Zeitschicht der jeweils beim ursprünglichen Erbau gültigen Bauordnung anwendet und nicht dem Umbau jetzt alles aufbürdet, was wir durch Baurechtsänderungen und DIN-Normen heute beachten müssen.
Andrea Gebhard: Allzu oft wird mit dem Bestand nur handwerklich umgegangen. Aber mit einer Wärmedämmverbundfassade oder Kunststofffenstern ist ihm nicht viel gedient. Im Gegenteil: Wir müssen mehr Fantasie, mehr Kreativität und mehr planerisches Know-how investieren. Dann erhalten wir auch Lösungen, die emotional berühren. Da kann der Bestand sehr inspirierend sein und möglicherweise Geburtshelfer einer neuen Baukultur unter Einbeziehung von Planenden, Bauausführenden und Immobilienwirtschaft.
Was entgegnen Sie denen, die sagen: „Aber Bestandsumbau ist komplizierter, unwägbarer und teurer.“?
Reiner Nagel: Wir führen aktuell Umfragen zum nächsten Baukulturbericht 2022/23 „Neue Umbaukultur“ durch, da begegnet uns genau diese Haltung. Viele Laien haben einen großen Respekt vor Umbauten. Die gleiche Frage haben wir auch Architektinnen und Ingenieuren gestellt: Die sehen im Bestandsumbau überhaupt kein Problem. Das heißt, je mehr wir dazu wissen, je mehr Erfahrung wir haben, desto weniger Risiken bestehen. Der Bestand braucht mehr Vorplanung und professionelles Hintergrundwissen. Dann können wir uns ihm mit überschaubaren Risiken nähern. Wenn man den Bestand rein handwerklich wieder in Schuss bringt, geht das sogar kostengünstig. Bei hochwertiger Erneuerung, inklusive Anbauten, Aufstockungen usw., liegt man in der Regel bei Neubaupreisen.
Andrea Gebhard: Es kommt auch darauf an, welche Kosten man betrachtet. Preise ich den CO₂-Verbrauch und die Folgekosten der Klimawende mit ein, ist Umbau immer günstiger. Allein der Rohbau macht ja über 50 Prozent aus. Ich sehe da auch öffentliche Auftraggeber in einer Schlüsselrolle. Bisher bauen diese, sofern der Umbau nicht weniger als 75 Prozent eines Neubaus kostet, eher neu. Es ist wichtig, dass da ein ganz klares Signal kommt, dass es nicht um die reinen Baukosten geht. Wobei die Material- und Energiepreise uns im Augenblick davongaloppieren. Wenn ich schon etwas habe, was ich nutzen kann, ist es vielleicht in naher Zukunft billiger, als neu zu bauen.
Reiner Nagel: Wenn die graue Energie und die Ressourcen, die mit dem Bestand verbunden sind, künftig mit einer CO₂-Steuer bepreist werden, dann wird das neue Bauen im Vergleich teurer und der Bestand erhält einen Bonus. Auch Arbeit wird im Verhältnis zu den Materialkosten billiger. Das Problem des Bestandes ist ja, dass er häufiger handwerklich weiterbearbeitet werden muss und Handwerk im Vergleich zu maschineller Arbeit teuer ist. Da ist es dann bisher häufig ein Reflex, abzureißen und etwas Neues hinzustellen. Das betrifft weniger die ortsbildprägenden Bauten, auf die wir immer gucken, sondern die Alltagsbauten, wo der Bodenwert entscheidend ist.
Brauchen der Bestand und eine Umbaukultur auch ein anderes Prestige?
Andrea Gebhard: Da ist schon eine Trendwende im Gange. Es wäre aber wichtig, dass diese auch die Immobilienwirtschaft erreicht. Die sieht oft noch schneller die Möglichkeit, abzureißen und neu zu bauen. Da spielen die Kosten, die wir gerade diskutiert haben, eine große Rolle. Daher ist es wichtig, dass die CO₂-Bepreisung wirklich kommt. Und dass auch bei der Förderung der Umgang mit CO₂ insgesamt bewertet wird.
Reiner Nagel: Die professionelle Immobilienwirtschaft reißt grundsätzlich schneller ab als private Bauherren und Eigentümer, die bemühen sich eher, etwas aus dem Bestand zu machen. Die Immobilienwirtschaft denkt häufig in der Kategorie „Abriss – Neubau“, um es sich einfacher zu machen, aber auch, um den Bodenwert zu steigern. Da zählt nicht der Wert des Betons. Das sogenannte Betongold gibt es gar nicht, sondern eigentlich ist es „Bodengold“. Häufig wird sogar der Sachverhalt umgedreht: „Jetzt haben wir abgerissen, das rechnet sich für uns nur, wenn wir die doppelte Nutzung genehmigt bekommen.“ Da muss man also genauer hinschauen: Ersatzneubau heißt Ersatzneubau, das ist dann nicht die doppelte Brutto-Geschossfläche, sondern das, was fürs Ortsbild verträglich ist. Vor diesem Hintergrund ändert sich auch der wirtschaftliche Blick auf den Bestand. Dazu braucht es aber eine konsequente Politik in den Gemeinden.

Wie kann da die Bundesstiftung Baukultur helfen? Sie planen, bauen und finanzieren ja nicht selbst.
Reiner Nagel: Informieren ist, wie gesagt, schon Teil des Geschäfts. Zumindest private Bauherren informieren sich ja am Markt, bei Handwerkerinnen oder Architekten. Wenn sie dann von uns umfangreiche, gut recherchierte Antworten auf die Frage nach Erhalt, Um- oder Neubau bekommen, ist ihnen geholfen. Und dann müssen wir in der Sache werben, wie das Deutsche Architektenblatt auch. Das gute Beispiel wirkt sehr fördernd.
Andrea Gebhard: Einer der großen Verdienste der Bundesstiftung Baukultur ist, dass der Baukulturbericht inzwischen ein Standardwerk ist für alle, die mit Planen und Bauen zu tun haben oder hierfür politisch Verantwortung tragen. Als Bundesarchitektenkammer nutzen wir diese Kommunikation natürlich, um beispielsweise auch die im Stiftungsrat der Bundesstiftung Baukultur vertretenen politisch Verantwortlichen für unser gemeinsames Anliegen einer flächen- und ressourcenschonenden Umbaukultur zu gewinnen.
Wäre eine Welt ohne Neubau – Umbauen und Weiterbauen nicht eingerechnet – denkbar? Und wäre sie überhaupt wünschenswert?
Andrea Gebhard: Ich bin absolut dagegen, zu sagen, es darf nur noch umgebaut werden. Das muss immer geprüft werden, auf den Ort, die Struktur und die Aufgabe bezogen. Wenn das mit einem großen Know-how entwickelt wird, auch alte Materialien mitverwendet werden, kann es auch ein Neubau sein. Aber der Flächenverbrauch muss verringert werden – was nur funktioniert, wenn es eine echte Vorgabe ist und nicht nur eine Absichtserklärung. Dies bedeutet auch einen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Es ist wichtig, dass wir uns als Gesellschaft dazu bekennen. Und da ist auch die Bundesstiftung Baukultur enorm hilfreich, die mit guten Bildern immer wieder zeigt, was geht.
Reiner Nagel: Eine auf den Neubau setzende Stadtentwicklung im Sinne von: nächster Erweiterungsring, nächstes Baugebiet: Das ist nicht wünschenswert. Da verlieren wir uns, im wahrsten Sinne des Wortes: mobilitätsbezogen, ressourcenbezogen, gesellschaftlich. Gleichzeitig gibt es in den großen Städten große Nachfrage, insofern dann auch die Berechtigung, Neubauquartiere zu entwickeln. Umgekehrt sind aber auch viele Konversionsflächen noch verfügbar und teilweise im Eigentum des Bundes.
Andrea Gebhard: Wahnsinnig viel Fläche ist im Augenblick auch noch dem Verkehr gewidmet. In jeder Stadt gibt es große Parkplätze oder riesige Einfahrtstraßen, die viel kleiner sein können.
Reiner Nagel: Natürlich wird auch neu gebaut werden müssen, weil wir neue Anforderungen haben – aber nicht zwangsweise. Im Gesundheitsbau fällt mir dazu etwa das Klinikum in München Großhadern ein. Es ist absurd, dass es nach vierzig Jahren komplett abgerissen wird, nur weil die Medizintechnik andere Räume fordert. Und wenn die fertig sind, hat die Medizintechnik schon wieder andere Labore. Also muss schon wieder abgerissen werden? Das können wir uns nicht mehr leisten. Wir müssen den neuen Bestand, also das, was neu gebaut wird, so umbaufähig bauen, dass es eine verringerte Amplitude von Neubauzyklen gibt.
Andrea Gebhard: Und wir müssen beim Bauen schon mitbedenken, wie zurückgebaut werden kann. Da helfen uns digitale Instrumente, sodass man hinterher weiß, was in dem Gebäude drin ist. Bisher sieht man das oft erst, wenn man es aufmacht. Das hält auch viele Menschen vom Umbau ab. Deshalb brauchen wir gut dokumentierte Logbücher für Gebäude.
Gefordert sind jährlich 400.000 neue Wohnungen – am besten billig und schnell. Ist das in Ballungsräumen realistisch mit dem Bestand abzudecken?
Reiner Nagel: Teilweise ja, durch Umnutzungen und die Entwicklung auf Konversionsflächen. In Ballungsräumen fließt ansonsten ein großer Teil des Bedarfs durch die Stadtflucht in die Landkreise und dort in die Einfamilienhausgebiete. Viele Gemeinden stellen immer weiter neue Baugebiete zur Verfügung, und die Bereitschaft, das angesichts der Nachfrage raumordnerisch zu akzeptieren, ist hoch. Im Ergebnis leidet die Baukultur. Da ist es besser, den Druck auf der Pipeline der Innenentwicklung zu lassen und den Qualitätsanspruch hochzuhalten. Auch zuletzt, als etwa 300.000 Wohnungen pro Jahr gebaut wurden, waren immer gut ein Drittel davon Einfamilienhäuser – aber das waren 62 Prozent der Wohnbaufläche! Das sind große Wohnungen mit 150 Quadratmetern und mehr – und im Grunde eine Art Rebound-Effekt beim Wohnen. Wir haben einerseits eine scheinbare Wohnungsnot, wobei unsere Wohnflächen weiter steigen.
Andrea Gebhard: Demnächst stehen gerade in den Ballungsräumen viele Flächen zur Verfügung. Viele Büroflächen, die jetzt leer fallen, weil sie nicht mehr flächeneffizient sind oder nicht mehr benötigt werden, ließen sich problemlos in Wohnungen umbauen. Für Einzelhandelsflächen mit tiefen Grundrissen gilt dasselbe. Da kommt sehr viel Umbaupotenzial auf uns zu, das man zum Vorteil der Innenstädte in Wohnungen umwandeln kann. Aber es braucht zwei Jahre, bis man den Vorlauf hat, das Leerziehen, die Planung und den Umbau. Sprich: Perspektivisch ist es mit dem Bestand zu machen, aber nicht ad hoc.
Ist prinzipiell der gesamte Bestand im Sinne einer „Umbaukultur“ erhaltenswert oder gibt es eine Grenze?
Andrea Gebhard: Ich glaube, dass man eigentlich aus fast allem was machen kann. Wenn man gute Architektinnen und Architekten ranlässt, entstehen fast immer sehr gute Konzepte. Wenn Sie das Siemens-Nixdorf-Gebäude am Anfang gesehen hätten, wie es aussah und wie schlecht es organisiert war … Und plötzlich ergaben sich durch eine neue Herangehensweise und eine neue Sichtweise darauf ganz andere Möglichkeiten. Da sieht man, wie aus einem hässlichen Entchen ein toller Schwan wird.
Reiner Nagel: Wir sind da nicht dogmatisch. Ich glaube, dass es im Einzelfall gute Argumente für Abriss und Ersatzneubau gibt. Was bautechnisch nicht zu retten ist, muss ausgetauscht werden. Auch Schönheit allein ist nicht das ausschlaggebende Kriterium. Ortsbildprägende Bausubstanz hat zwar den Vorteil, dass sie wie Denkmale von energetischen Sanierungszwängen befreit ist. Umgekehrt jedoch ist ein nichtssagendes Gebäude nicht zwangsläufig eines, das wegkann. Wenn man genauer hinguckt, kann da noch viel Potenzial drinstecken. Selbst wenn nicht: Dann kommt die Frage, inwiefern das Material rückbaubar ist. Schadstoffe sind übrigens nicht, wie häufig behauptet, ein Argument für Abriss. Nach einer Asbestsanierung zum Beispiel steht am Schluss der sanierte Rohbau da, auf dem auch wieder aufgebaut werden kann.
Andrea Gebhard: Da steht ein Perspektivwechsel an. Wo heute zu oft gesagt wird: „Du mit deinem langweiligen Umbau“, brauchen wir das Gegenteil: „Du mit deinem tollen Umbau!“ Fortschritt ist nicht nur, neu zu bauen. Fortschritt bedeutet, aus dem, was da ist, etwas Neues zu entwickeln.
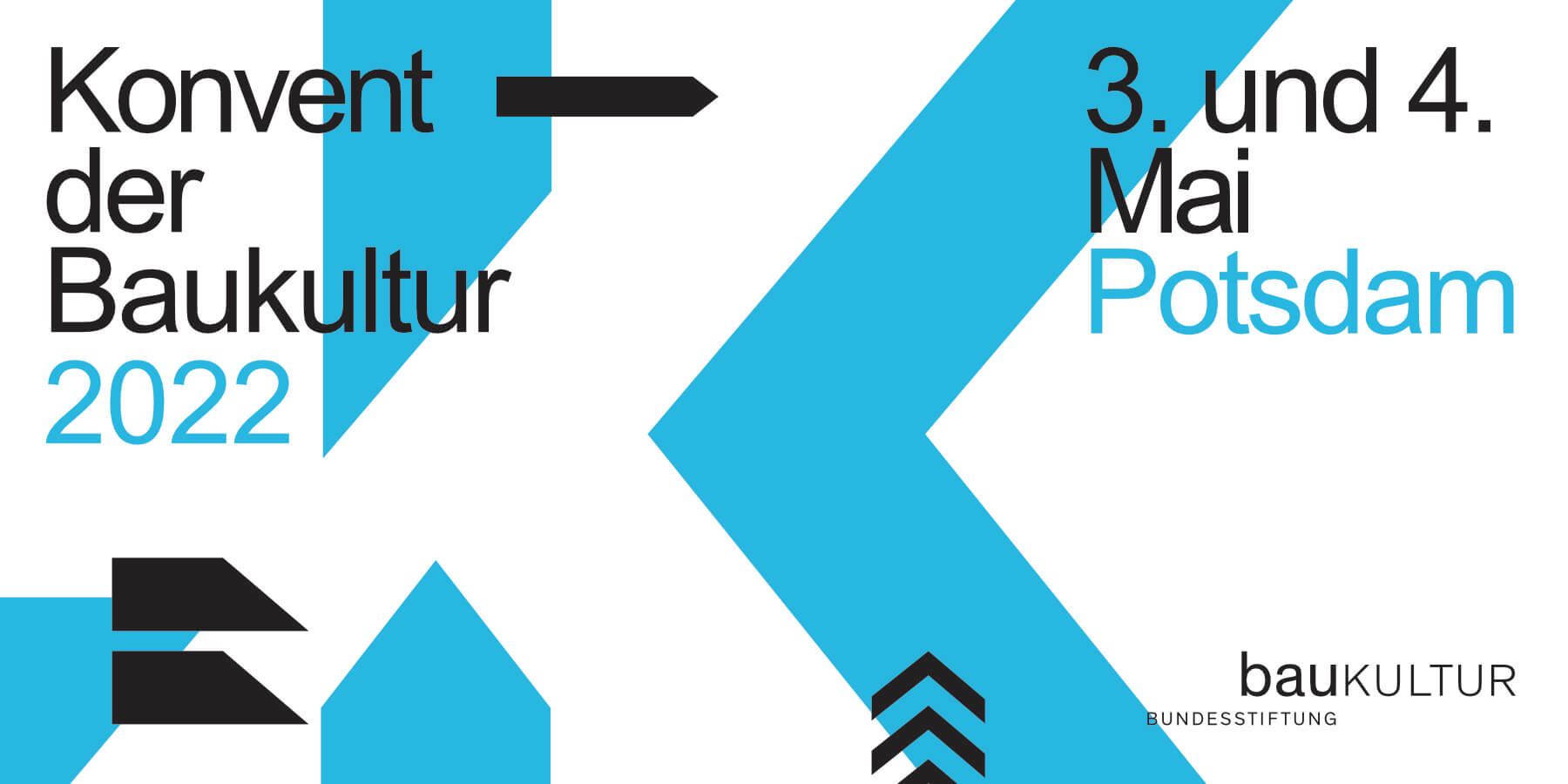
Auf dem Konvent der Baukultur am 3. und 4. Mai in Potsdam findet nicht nur die Gremienwahl der Bundesstiftung Baukultur statt, sondern auch ein umfangreiches Programm mit Abendempfang, Vernissage, Reden und Diskussionen: am ersten Tag in einem „Basislager der Baukultur“ etwa zu Baustoffen und Lebenszyklus, baukultureller Bildung oder handwerklicher Ausbildung.
Am zweiten Tag stehen Themen der Baukulturberichte im Fokus: zum Beispiel öffentliche Räume und Mobilität, Zukunft für Innenstädte und Ortskerne, aber auch Bau- und Planungsrecht. Die Teilnahme ist offen für alle und nach Anmeldung kostenlos.
War dieser Artikel hilfreich?
Weitere Artikel zu:


