
Interview: Roland Stimpel
Wir haben hier eine Liste, erstellt nach der Datenbank von Competitionline. Danach waren Sie seit dem Jahr 2000 in 25 Wettbewerbsjurys.
(Blickt kurz auf die Liste.) Da stehen nicht alle drin.
Wie viele kommen dazu?
Für die Vergangenheit kann ich es Ihnen nicht sagen. Momentan sind es etwa zwanzig Gremien. Aber nicht nur Jurys, sondern auch Gestaltungsbeiräte, die Leitungen kooperativer Verfahren und so weiter.
Wie kommt man in so viele Preisgerichte?
Ich bin Städtebauer, hatte ein eigenes Büro, war 14 Jahre lang als Kantonsbaumeister in der Politik und habe in Ländern wie Nigeria und China gearbeitet, also Erfahrung mit ganz unterschiedlichen Planungsaufgaben, Kultur- und Kommunikationssituationen. Das trainiert darin, sich mit Vielfalt auseinanderzusetzen und sich in Neues hineinzudenken. Es hat sich also aus meiner Berufstätigkeit heraus ergeben.
Oft sind Sie Juryvorsitzender. Reizt Sie da die Macht?
Die ist oft kleiner als bei Fachpreisrichtern. Der Vorsitzende sollte nicht in erster Linie eine inhaltliche Richtung weisen, sondern muss primär dafür sorgen, dass der Prozess kreativ und zielgerichtet abläuft. Er muss zunächst sicherstellen, dass das ganze Spektrum der angebotenen Lösungen ausdiskutiert wird. Er darf nicht von vornherein als Partei empfunden werden, kann aber durchaus in der Schlussphase den Prozess in eine bestimmte Richtung beeinflussen. Hierbei muss sein Ziel sein, dass sich am Ende möglichst alle Beteiligten mit einem Projekt identifizieren. Wenn dagegen eine Entscheidung mit sieben gegen sechs Stimmen droht, muss man anhalten und von vorn anfangen.
Kommt das öfters vor?
Ein definitives Scheitern habe ich nur einmal erlebt, bei einem Wettbewerb um das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Da waren die politischen und städtebaulichen Standpunkte und die Interessen so divergierend, dass es mir nicht gelungen ist, einen breit getragenen Konsens zu erreichen. Aber meist gibt es ihn.
Sollten Fachpreisrichter ähnlich konsensorientiert sein wie Juryvorsitzende?
Nein, als Fachpreisrichter muss man auch mal frech oder sogar arrogant sein, eine Position deutlich und selbstbewusst vertreten. Das belebt die Geister.
Überzeugt man so Juroren mit anderen Meinungen?
Der Einfluss beginnt schon vorher. Manche Preisrichter sind dafür bekannt, dass sie eine spezielle städtebauliche und architektonische Haltung einnehmen. Da wissen die Teilnehmer, dass seine Stimme laut sein wird. Und das bleibt nicht ganz ohne Einfluss auf die eingereichten Entwürfe.
Wenn Star-Architekten in Jurys gehen, wird ihnen oft eine autokratische Haltung nachgesagt.
Vor zehn bis fünfzehn Jahren kamen die Architekturkoryphäen und wussten nach einer halben Stunde, welches das beste Projekt ist. Aber die selbst ernannten Hohepriester verschwinden oder werden gar nicht mehr eingeladen. Einige sind auch wirklich nicht gesellschaftstauglich. Ihre Zeit ist auch deshalb vorbei, weil die Anforderungen an ein Projekt immer komplexer werden und entsprechend sorgsam geprüft werden müssen.
Wie finden eigentlich Fach- und Sachpreisrichter zueinander, wenn die einen vor allem auf Gestaltung gucken und die anderen auf Funktionalität und Kosten?
Nein, alle gucken auf alles, wenn auch mit unterschiedlicher Kompetenz und Gewichtung. Die Kunst liegt in der Auswahl eines Projekts, das überall einigermaßen in Ordnung, aber nicht banal ist.
Und wenn Sachpreisrichter zur Banalität neigen?
Man muss sie auch da ernst nehmen, wo nicht ihre größte Kompetenz liegt. Wenn sie etwas architektonisch oder städtebaulich Fragwürdiges wollen, dann sollte man ihnen das nicht auszureden versuchen, sondern sollte über die Ziele reden, die bei ihnen dahinterstehen.
Manchmal stoppt hinterher eine empörte Öffentlichkeit den Siegerentwurf. Sie haben das allein in den letzten zwei Jahren dreimal erlebt, beim Bauhaus Europa in Aachen, beim Hamburger Domplatz und beim Gewandhaus in Dresden. Was ist da schiefgelaufen?
Das waren unterschiedliche Dinge. In Hamburg war die Frage umstritten, ob der Ort überhaupt bebaut werden sollte – und wenn ja, ob für die vorgesehenen Nutzungen. In Aachen hat sich das Preisgericht inklusive der Fachpreisrichter einstimmig für den mutigsten, in die Zukunft weisenden Entwurf entschieden. Gerade das wollten aber viele Bürger zwischen Dom und Rathaus nicht. In Dresden dagegen haben wir das bescheidenste, städtebaulich zurückhaltendste Projekt ausgewählt. Es ist aber offensichtlich an dieser Stelle von Dresden nicht möglich, etwas anderes als ein historisches Falsifikat zu bauen.
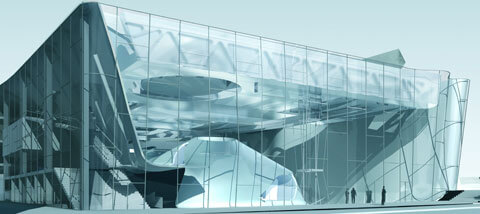
Haben Sie in den Preisgerichten schon darüber gesprochen, dass es Protest geben könnte? Und hatte das Einfluss auf Ihre Entscheidungen?
Ich habe mich in Jurys immer darauf verlassen, dass der Rahmen hält, den die Politik unseren Entscheidungen setzt, und dass wir in diesem Rahmen frei entscheiden konnten. Wir alle, einschließlich der Politiker im Preisgericht, haben uns stets gesagt: Wir versuchen es. Ich habe bis jetzt keine Protestgruppen innerhalb der Jury erlebt.
Und die außerhalb waren kein Thema?
Die Qualität der Entwürfe war unser Thema. Aber es hat sich ein in Deutschland häufiges Phänomen gezeigt, nämlich die Existenz zweier Politikebenen, die einander nicht akzeptieren. Auf der einen agieren offiziell gewählte Politiker, auf der anderen diejenigen, die sich von ihnen nicht vertreten fühlen. Aus der Schweiz kenne ich dies nicht, da sind die Ebenen viel näher beieinander. Das liegt auch daran, dass vieles in Volksabstimmungen entschieden wird.
Auch innerhalb von Jurys kann es Grundsatzstreit geben, zum Beispiel den zwischen avantgardistischen, traditionell-modernen und auf noch frühere Zeiten zurückgreifenden Haltungen. Was macht eine Jury, wenn unvereinbare Werte aufeinanderprallen?
Sie sollten gar nicht erst prallen. Bei schwierigen und anspruchsvollen Projekten in Basel habe ich mit dem Preisgericht zunächst eine Reise zu vergleichbaren Bauten gemacht. Das ergibt von allein ein Gespräch darüber, wie man mit einer solchen Aufgabe umgeht. Dann geht man in die eigentliche Jurysitzung ganz anders hinein. Abstrakte Haltungen werden unwichtiger, das konkrete Problem rückt in den Mittelpunkt. Viel schlechter läuft es, wenn man Juroren mit verschiedenen Positionen unaufgewärmt aufeinander loslässt. Die werden sich dann mehr über ihre Positionen als über das jeweilige Projekt streiten. Noch schlimmer wird es, wenn sie verschiedene Sprachen sprechen.
Wie können Auslober das Dilemma lösen, die zwar Juroren mit unterschiedlichen Haltungen wünschen, aber keinen Grundsatz- und Glaubensstreit?
Wo immer möglich sollten sie keine Ideologieträger berufen. Da gibt es nur wenige Ausnahmen. Hans Kollhoff zum Beispiel hat ausgeprägte Meinungen, aber er besteht nicht darauf, wenn er sieht, dass eine Jury so nicht weiterkommt.
Beim Berliner Schlosswettbewerb klagten Juroren über zu enge Vorgaben bei den Fassaden.
Ein Auslober darf jede Vorgabe machen. Was man hier sieht, ist genau die Verachtung der Politik, die ich immer wieder feststelle. Man muss aber mit ihr arbeiten, statt sie zu bekämpfen. Und wenn man die Vorgabe heikel findet, muss man nach einer Sublimierung suchen. Und andere Positionen darf man nicht blind bekämpfen, sondern muss sie mit Respekt und Zuneigung hinterfragen. Sonst wächst der Verdacht gegen Architekten, dass sie nicht auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen eingehen. Es ist existenziell für uns, da neues Vertrauen zu schaffen.
Der wohl grausamste Teil des Jurierens ist das Aussondern von Entwürfen. Mit einer kurzen Entscheidung wird da die Arbeit von Monaten verworfen.
Gerade darum darf es nicht mit Vorurteilen, sondern muss es mit Respekt gemacht werden. Es darf nicht nach 30 Sekunden heißen, dies sei aber ein mieser Entwurf. Man muss schon bei jedem Projekt genauer hinschauen, bis man entweder angeregt wird oder zu der fundierten Überzeugung kommt, dass dieser Entwurf nicht weiterführend ist.
Bei offenen Wettbewerben mit Hunderten Teilnehmern sind 30-Sekunden-Urteile kaum zu vermeiden.
Solche Wettbewerbe sind in der Tat viel zu groß. Und während man einerseits vor einem Berg von Entwürfen steht, machen andererseits manche Architekten nicht mit, von denen man gern einen Entwurf sehen würde. Darum setze ich mich auch für Beschränkungen ein.
Dann bekommen immer nur die Gleichen eine Chance.
Ich bin ein Verfechter mehrstufiger Verfahren. Dabei soll für die Präqualifikation nicht die Zahl der Bürocomputer eine Rolle spielen oder der Umsatz im Vorjahr. Sondern die Haltung, die sich in realisierten Projekten oder in Selbstdarstellungen äußert. Auf dieser Grundlage können 25 bis 30 Büros eingeladen werden.
Aber schließt das nicht auch die ganz Jungen und die sich neu Orientierenden aus?
In der Schweiz gibt es fast immer einen Extratopf für Junge; das finde ich wichtig. So haben wir dies auch bei sehr großen Projekten gehandhabt, zum Beispiel beim Wettbewerb für die Erweiterung des Kunsthauses in Zürich. Ich appelliere immer wieder an die Auslober, nicht nur die Dinosaurier einzuladen. Nötig sind doch die Architekten, die innovativ und überraschend mit dem Ort umgehen.
Wenn dann die Entwürfe eingereicht sind: Erkennen Sie öfter Kollegen an typischen Entwurfsmerkmalen?
Solche Vermutungen sind heute sehr viel schwieriger als früher. Da gab es oft buchstäblich eine individuelle Handschrift oder Zeichenmethode. Die Computer haben das weitestgehend anonymisiert.
Und die architektonische Handschrift?
Gerade einige der erfolgreichsten Büros von heute sind daran nicht erkennbar. Der phänomenale Erfolg von Herzog & de Meuron zum Beispiel liegt doch darin, dass sie auf jeden Ort individuell eingehen und für jeden etwas Neues erfinden, statt immer das Gleiche zu entwerfen.
Wettbewerbskritiker behaupten, dass das Verfahren Entwürfe mit allzu starker Auffälligkeit und mit teils bemühter Originalität begünstige. Denn was einfach nur unspektakulär und gefällig sei, fliege meist gleich im ersten Rundgang hinaus.
Ab und zu gewinnen die lauten Wichtigtuer, vor allem bei privaten Investoren, die in erster Linie nach einem sogenannten Alleinstellungsmerkmal suchen. Aber oft gewinnen auch die differenzierten, integrativen Projekte. Zum Beispiel in diesem Sommer der Entwurf von Wandel, Hoerfer, Lorch und Hirsch für die archäologische Zone am Kölner Rathaus. Er bildet die historischen Räume wieder aus und zeigt eine zeitgemäße, zugleich dem Ort angepasste und nicht aufdringliche Architektur.
Können acht Wettbewerbssieger um einen Platz ein Ensemble bilden oder werden das stets acht Solisten?
Es kommt darauf an, ob man ein robustes städtebauliches Konzept hat. Auf dem Debis-Areal am Potsdamer Platz in Berlin zum Beispiel war es fast genau wie in Ihrer Frage: Der Raum war leer, in ihm ist nach dem städtebaulichen Konzept von Renzo Piano ein Ensemble entstanden.
Viele Aufgaben werden ganz ohne Wettbewerb vergeben. Was lässt sich tun, um das zu ändern?
Es gibt zwei verschiedene Ursachen dafür. In Städten, wo sich die Politik nicht der Bedeutung der Gestalt der Stadt bewusst ist, gehen die Investoren gerne den für sie scheinbar einfachsten Weg. Da muss sich die Politik einschalten. Ein Gestaltungsbeirat kann dabei helfen. Die andere Ursache ist, dass Wettbewerbe nicht für jeden Ort und jede Aufgabe das angemessene Verfahren sind. Sie sind nur dann richtig, wenn das Produkt und das Programm klar definiert sind und wo die Einbettung in den Ort und das Gefüge der Stadt frei von grundsätzlichen Widersprüchen ist. Wo aber keine eindeutige Aufgabe gestellt wird und wo grundlegende Widersprüche noch ungelöst sind, da sind die Teilnehmer überfordert und der Wettbewerb ist mit Erwartungen überfrachtet. Er kann auf keinen Fall der Ersatz für eine politische Grundsatzentscheidung sein.
Gerade bei Rat- und Orientierungslosigkeit kann eine kreative Lösung den Knoten platzen lassen.
Aber der Wettbewerb kann kaum aus einer ungeklärten Situation zu einer konsensfähigen Lösung führen. Dafür sind Prozesse besser geeignet, in denen Konflikte integriert und Gegensätze offen ausgetragen werden, zum Beispiel kooperative Verfahren. Es geht da nicht zuletzt um die Öffentlichkeit und ihre vielfältigen, oft widerstreitenden Interessen.
Droht da nicht ein lauer Kompromiss statt einer zukunftsweisenden Juryentscheidung?
Ich finde nicht, dass Jurys immer die zukunftsorientiertesten Gremien sind. Im Gegenteil: Gerade Fachleute sind oft beharrende Kräfte, die an alten Grundsätzen und Denksystemen festhalten. Heute sind zum Beispiel Städte bei der Suche nach Verfahren und dem Umgang mit der Öffentlichkeit oft innovativer, als manchen Experten recht ist.
Das mag Verfahren betreffen – aber auch Inhalte?
Da bildet sich glücklicherweise bei den Fachleuten eine elitäre Position der 80er- und 90er-Jahre stark zurück, in denen es hieß: Bevölkerung und Politiker sind dumm. Nein, sie denken nur anders. Und oft sogar unbefangener.
Droht in kooperativen Verfahren die Gefahr eines Einheitsbreis, weil jeder vom Entwurf der anderen weiß?
Ich habe schon oft an städtebaulichen Verfahren teilgenommen, in denen die Büros die Entwürfe der anderen jeweils kannten. Da nähern sich ihre Positionen im Lauf des Verfahrens nicht etwa an, sondern entwickeln sich auseinander – ganz einfach, weil alle sich profilieren und voneinander abgrenzen wollen.
Was sagen Sie den jungen und kleinen Büros, die zu solchen Verfahren gar nicht erst eingeladen werden?
Ich kann nur um Verständnis bitten, dass es sich hier oft um komplexe primär städtebauliche Aufgaben handelt, die einschlägige Erfahrungen und Planungskapazitäten erfordern. Und ich sage auch: Man kann nicht immer die Verfahrensform wählen, die Architekten am besten fänden. Sondern es muss diejenige sein, die dem jeweiligen Problem am besten gerecht wird. Bei definierten architektonischen Aufgaben sind das natürlich Wettbewerbe. Und da engagiere ich mich sehr, dass auch weniger bekannte Büros eine Chance bekommen.
Carl Fingerhuth, 72, studierte Architektur in seiner Geburtsstadt Zürich, hatte ein Planungsbüro, unter anderem mit Aufgaben in Nigeria und China, und war von 1979 bis 1992 Kantonsbaumeister von Basel-Stadt. Seit 1992 hat er wieder ein Büro für Städtebau in Zürich, lehrt das Fach an der TU Darmstadt, ist als Juror und Berater tätig – derzeit unter anderem in den Gestaltungsbeiräten von Köln, Regensburg und Karlsruhe.

