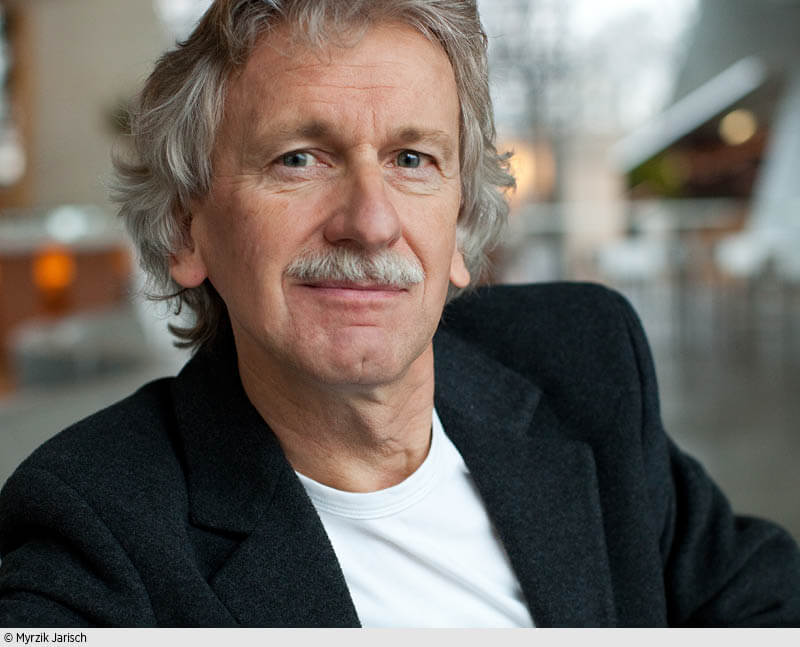
Text: Wolfgang Bachmann
Jedes Jahrzehnt hat seine Sprache und seine Vorzugsattribute. Zu den Glanzzeiten der Postmoderne hielten Architekturschreiber das Wort „ironisch“ griffbereit. Es diente dazu, die nicht ernst gemeinte Wiederkehr klassischer Details an den Fassaden von städtischen Mietshäusern zu rubrizieren, schützte aber auch die Autoren bei ihrer Analyse, da es offen blieb, ob sie mit ihrer Kritik nicht nur eine Kostprobe ihres feuilletonistischen Talents geben wollten. Einige Jahre später, als ein mächtiger Senatsbaudirektor Berlin vor dem Wildwuchs internationaler Architektur beschützte, wurde gerne das Verdikt „faschistisch“ als Geschmacksverstärker platziert, um die Unmöglichkeit von Steinhäusern mit Lochfenstern und moderater Traufhöhe zu benennen.
Überspringen wir die splitterigen Vokabeln, mit denen Dekonstruktivismus und Zeitgeist literarisch zusammengeführt wurden. Sehen wir in die Gegenwart. Da werden „Paradigmen“ wie Windeln gewechselt, und „parametrisches“ Entwerfen wird erwähnt, um zu sagen: Wir haben studiert, als es noch keine Taschenrechner und Handys gab, aber lasst die jungen Leute an den Hochschulen ruhig ihre Erfahrungen sammeln. Sehr beliebt ist es, das Wort „dystopisch“ einzuflechten. Der altmodische Untergang des Abendlandes lässt sich damit „diskursiv“ aufwerten. Das zeigt, dass man Architektur nicht isoliert betrachtet, denn es hängt ja alles mit allem irgendwie zusammen. Auch den Begriff „performativ“ möchte man nicht missen, viel kürzer als zu sagen: Der Weg ist das Ziel, wir sprechen beim Bauen. Und oft überzeugt dann ein Wort wie „reflexiv“ von der selbstkritischen Räson des Verfassers.
Einen Höhepunkt des inflationären Gebrauchs erreicht schließlich das populäre „urban“. Damit lassen die Autoren ihre neoliberale, gesellschaftspolitische Sensibilität erkennen. Es geht nicht um das Haus, sondern um die Stadt, wo man dem „Idiotismus des Landlebens“ entkommt. Die Indizien sind zahlreich: je mehr Heizpilze in den Straßencafés, um so „urbaner“ lebt es sich im Prosecco-Gürtel. Und dann füttern wir Tauben im Park, wo die Türken friedlich grillen.
Ja, es gibt kein Gift dagegen. Wir pflücken die reizenden Schlingpflanzen der Begriffe für unsere Texte und können uns damit prima verständigen. Manchmal merken wir es.
War dieser Artikel hilfreich?
Weitere Artikel zu:

