
Philipp Meuser
Barrierefreie Architektur – das klingt nach Seniorenheim, Behindertenwohnung oder Krankenhaus. Nach wie vor werden mit diesem Begriff Bauten für „benachteiligte Randgruppen“ assoziiert. Doch barrierefreie Architektur wird längst nicht nur von behinderten oder alten Menschen geschätzt. Denn behindert sein heißt nicht nur, sich aus physischen Gründen dauerhaft eingeschränkt in seiner Umgebung zurechtfinden zu müssen. Behinderung kann auch situativ sein. Dann nämlich, wenn jemand voll bepackt eine Treppe hinaufsteigen muss, mit dem Einkaufswagen vom Laden nicht zum Auto auf den Parkplatz kommt, mit dem Kinderwagen hilflos vor einer Treppe steht oder nicht weiß, wie er damit vom Bahnsteig in die Straßenbahn gelangen soll.
Deshalb gibt es heute Niederflurstraßenbahnen und -busse mit entsprechend angepassten Bahnsteigen. Gerade die neuen Techniken öffentlicher Verkehrsmittel belegen, wie weit sich der Begriff des „Behindertseins“ inzwischen geöffnet hat – und wie universell die Lösungen für einen barrierefreien Zugang sein können. Danach gilt als Faustregel: Wo ein kleines Kind bequem einsteigen kann, ist es für den Greis am Gehstock gerade richtig; und was einer Mutter mit Kinderwagen entgegenkommt, dient auch Menschen mit Krücken, Rollator oder Rollstuhl.

Es geht also nicht mehr um den politisch korrekten und bisweilen völlig überzogenen Anspruch, ein Gebäude „rollstuhlgerecht“ herzurichten; es geht vielmehr um eine Barrierefreiheit, die nicht stigmatisiert wird oder eine Alibifunktion erfüllt, sondern selbstverständlich ist. Barrierefreiheit berücksichtigt menschliche Fähigkeiten und Ausprägungen aller Art: ältere Menschen, stark Gehbehinderte, Seh- und Hörbehinderte, klein und groß gewachsene Personen, Kinder, Schwangere sowie Menschen, die aufgrund von Krankheit oder Verletzungen in ihrer natürlichen Bewegungs- und Wahrnehmungsfähigkeit zumindest temporär eingeschränkt sind.
Barrierefreies Bauen bedeutet, unsere von Menschenhand geschaffene Welt – vom Bürgersteig über das Haus bis zum Lichtschalter – so anzulegen, dass sie allen Menschen unabhängig von ihrer jeweiligen körperlichen Verfassung oder ihrem Alter ohne fremde Hilfe und uneingeschränkt offensteht. Die barrierefreie Gestaltung des menschlichen Lebensraums wird daher längst als „Bauen und Gestalten für alle“ oder „menschengerechtes Bauen“ definiert.
Zahlreiche Berichte und Gutachten aus Deutschland und den europäischen Nachbarländern kommen zu dem Schluss, dass eine barrierefrei zugängliche Umwelt für etwa zehn Prozent der Bevölkerung zwingend erforderlich, für bis zu 40 Prozent immerhin notwendig und für 100 Prozent schlicht komfortabel ist. Weil sich das Bedürfnis nach Bequemlichkeit nicht auf eine Minderheit beschränkt, ist barrierefreies Bauen nicht mehr nur eine Aufgabe für Randgruppen, sondern Ausdruck der Emanzipation einer ganzen Gesellschaft.
Dies belegt schon die offizielle Sprache. Denn mit dem Begriff „Barrierefreiheit“ gewinnt das, worum es geht, einen allgemeingültigen, ja egalitären Charakter. „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“, heißt es im Grundgesetz, wenn auch erst seit 1994. Doch nicht nur Rechtsansprüche von Behinderten werden unsere gebaute Umwelt verändern, sondern mindestens ebenso stark der Alterungsprozess der Gesellschaft.
Von Seh- und Gehhilfen über Hörgeräte bis hin zu Rollstühlen – eine ganze Industrie sorgt bereits dafür, dass Lahme gehen und Blinde „sehen“ können. Sie sind dank Erfindungen wie der Braille-Blindenschrift oder der Prothesentechnik besser in der Lage, am öffentlichen Leben teilzuhaben und ihren Alltag zu organisieren. Was hingegen noch aussteht, ist die entsprechende Anpassung der Hardware dieses Alltags – nämlich die Architektur. Dass die Bedürfnisse und Ansprüche von Behinderten dabei als Richtschnur dienen, versteht sich zunächst von selbst.
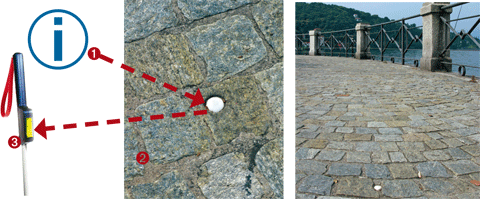
Schon jetzt spiegelt das Kompendium gesetzlicher und normativer Bestimmungen, die den Alltag der Bauwelt heute prägen, diese Einsicht wider. Während „Barrierefreies Bauen“ in den Achtzigerjahren mit dem wenig treffenden Begriff „Bauen für Behinderte“ gleichgesetzt wurde, hat sich in den 1990er Jahren ein Bewusstseinswandel vollzogen. Auch in die Bauordnungen der Bundesländer hat das Thema längst Einzug gehalten und ist zu einem bedeutenden Aspekt bei öffentlichen Vorhaben geworden – aber auch im Wohnungsbau.
So schreiben Birgit Jürgenhake und Bernard Leupen von der Universität Delft: „Eigentlich muss ein Architekt heute fast davon ausgehen, dass er für das ‚Unbekannte‘ entwirft, dass die Wohnung so flexibel sein muss, dass sie immer auf die Dynamik der Gesellschaft reagieren kann und immer wirtschaftlich interessant bleibt.“ Das erfordert eine Baukultur, die nicht nur an Mindesttürbreiten orientiert ist, sondern Wohnraum für alle Lebenslagen und -phasen hervorbringt. Dies kommt auch Menschen entgegen, die temporär in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, etwa wenn sie durch Krankheit geschwächt oder bettlägerig sind.
Altbauten wie Reihenhäuser oder Maisonettewohnungen erscheinen zunächst nur schlecht nutzbar für eingeschränkt mobile Menschen. Aber auch bei ihnen ist ein Umbau möglich. Grundrisse können beispielsweise so umgestaltet werden, dass alle Wohnfunktionen auf einer Ebene zusammengefasst und sinnvoll integriert werden. Auch die Stadtplanung ist gefragt: Geschäfte, Arztpraxen oder Apotheken sollten möglichst nah an der Wohnung liegen und leicht erreichbar sein. Barrierefreies Bauen ist also auch ein Weg zurück zur Stadt der kurzen Wege.
Seit der Begriff „Barrierefreies Bauen“ Anfang der Neunzigerjahre Einzug in die Architektur gehalten und den eher fragwürdigen Begriff „Bauen für Behinderte“ abgelöst hat, haben zahlreiche Hersteller ihre Produkte verbessert. Ein Behinderten-WC oder ein Rollstuhl dürfen heute ästhetisch sein. Dies mag auch der Erkenntnis zu verdanken sein, dass in einer alternden Gesellschaft der Bedarf an barrierefreien Produkten steigen wird.
Aller Voraussicht nach werden Hersteller in 20 Jahren ihre Produkte nicht mehr als barrierefrei kennzeichnen müssen, weil dies allgemeiner Standard ist. Eine völlig andere Branche, die Internetindustrie, zeigt unter dem Begriff „Barrierefreies Design“, wie die gesamte Bevölkerung ohne große Ideologie von einer verständlicheren Bedienbarkeit profitieren kann. Diese Selbstverständlichkeit im Planen und Bauen zu erreichen, ist die Aufgabe der gegenwärtigen Architektengeneration.
Philipp Meuser ist Architekt und Verleger in Berlin. Der Text fasst die Einleitung des unten vorgestellten Buchs zusammen, dem auch Abbildungen für dieses Heft entnommen sind.
Joachim Fischer/Philipp Meuser (Hg.):
Barrierefreie Architektur – Handbuch und Planungshilfe
Barrierefrei bauen bedeutet nicht nur breite Türen, niedrige Lichtschalter und am Hintereingang versteckte lieblose Rollstuhlrampen. Das zeigt dieses Buch mit Überblickstexten zum Thema, besonders aber mit seinen rund 50 aktuellen Projektbeispielen, die umfangreich in Texten, Fotos, Plänen und Zeichnungen präsentiert werden. Sie vermitteln eine moderne Formensprache, mit deren Hilfe zeitgemäße Lebensräume für den Menschen geschaffen und gestaltet werden. Hinzu kommt ein illustrierter Kommentar zur DIN 18025.
DOM publishers Berlin, 304 Seiten, 78 Euro


