

Text: Christoph Gunßer
Klaus Kinold, einer der führenden Architekturfotografen hierzulande, hat einmal gesagt: „Ich will die Architektur zeigen, wie sie ist.“ Menschen hat er komplett aus seinen Bildern verbannt. Sein Kollege Wilfried Dechau, lange Jahre Fachjournalist und heute Leiter einer Galerie für Architekturfotografie in Stuttgart, erwidert Kinold: „Wenn das doch so einfach wäre, wie es klingt. Wie ist Architektur und wann ist sie wie? Ist sie menschenleer, ‘wie sie ist‘? So jedenfalls sehen Architekten ihre Bauten am liebsten in den Magazinen: ganz clean.“
Welche Ursprünge dies hat und in welcher Tradition es steht, zeigt eine kleine Geschichte der Architekturfotografie. Sie beginnt mit einer technischen Beschränkung: In den Jahrzehnten ab 1843, als die Fotografie erfunden wurde, waren Häuser die bevorzugten Motive der Fotografen allein deshalb, weil die Belichtungszeiten der Kameras lang und daher keine bewegten Objekte abbildbar waren. Und wenn Menschen abgelichtet wurden, wirkten sie selbst wie in Stein gemeißelt, stocksteif, denn es galt, fürs begehrte Porträt die Luft anzuhalten.

Erst als die Kameras um die Jahrhundertwende handlicher wurden, gewannen subjektive Momente an Bedeutung. Mensch und Tier durften sich fortan zwanglos geben; die Reportagefotografie wurde geboren. Die Architekten der klassischen Moderne und ihre Fotografen hielten indes nichts von solch zweckfreien Wimmelbildern. „Neue Objektivität“ hieß die prägende Schule der sachlichen Zwanzigerjahre – eine Tradition, die bis zum oben zitierten Eiermann-Schüler Klaus Kinold überdauern sollte. Dokumentarisch kühl und anonym sind etwa die Bilder des „Neuen Frankfurt“ oder der Stuttgarter Weißenhofsiedlung zur Entstehungszeit.
Die „Phönix aus der Asche“-Ästhetik unterstrich den radikalen Bruch mit dem Gewesenen. Sie verschwieg aber mangels technischer Möglichkeiten die zuweilen intensive Farbigkeit der Räume und Materialien. Damals wie heute diente die Reduktion vor allem dem Zweck, die skulpturale Autonomie und Zeitlosigkeit der Gebäude hervorzuheben.
Was nicht bedeutet, dass es in den Bildern moderner Meisterwerke nicht Spuren außerarchitektonischer Belange gab. So ließ Le Corbusier vor seinen Villen beim Fototermin regelmäßig die neuesten Automobile parken, um dem Betrachter den Analogieschluss nahezulegen, hier stünden die beiden avanciertesten Errungenschaften der Zeit – ein Kunstgriff des Imagineering, der bis heute verfängt. In seinem Pamphlet „Vers une Architecture“ von 1923 benutzte Le Corbusier ebenso ungeniert Elemente der Werbung wie Rem Koolhaas in seinem Wälzer „S, M, L, XL“ siebzig Jahre später.
Le Corbusier war zugleich Künstler genug, um zu erkennen, dass auch seine Interieurs etwas „Leben“ vertragen könnten. So unterdrückte er zuweilen den modernen Reinlichkeitsfimmel und platzierte zum Beispiel in der Küche der Villa in Garches einen Krug und einen krustigen Brotlaib auf der glatten Arbeitsplatte.
Noch viel lebendiger ging es freilich in Corbus Sozialbausiedlung im südfranzösischen Pessac zu: Die Bewohner eigneten sich die offenbar allzu schlichten Häuser mit der Zeit fantasievoll an. Die unordentliche Transformation der Siedlung Pessac hat der Fotograf Philippe Boudon 1972 in einem Buch mit dem Titel „Lived-in Architecture“ publiziert. Lange vorher hatte le Corbusier die Größe gezeigt, vor der Vitalität des Alltags den Hut zu ziehen: „Es ist immer das Leben, das Recht hat, nicht der Architekt.“
Weise Demut dieser Art war jedoch unter den Baumeistern jener Jahre selten, und so musste die Wahrheit über so manche moderne Untat „von unten“ wachsen. Die Fotografie erwies sich dabei als mächtige Waffe. Und seit den protestfreudigen Sechzigerjahren machte sich auch in der Fotografie eine Respektlosigkeit vor Autoritäten breit, die den Blick auf die angeblichen Meisterwerke von Denkverboten befreite.
Postmoderne Kritik zeigte so an vielen Beispielen, dass der Kaiser (in Gestalt zuvor hochgelobter Architekturen) in Wirklichkeit ziemlich nackt dastand und dass gleichzeitig die angeblich so unwissenden und unfähigen „Massen“ durchaus zu bauen verstanden – auch wenn Selbsthilfe überhaupt nicht dem herrschenden modernen Reinheitsgebot entsprach. „Architektur ohne Architekten“ (so Bernard Rudofskys berühmter Buchtitel von 1964) war für die Zunft eine Provokation.
Die viel zitierte „Unwirtlichkeit unserer Städte“, sie ließ sich in Fotografien belebter oder eben nicht belebter Straßenzüge trefflich illustrieren; das Pamphlet „Die gemordete Stadt“ lebte mindestens so stark von den Fotografien Elisabeth Niggemeyers wie von den Texten Wolf Jobst Siedlers. Sehr wirksam waren stets auch Gegenüberstellungen des Zustandes vor und nach einer Baumaßnahme – oder direkt nach der Fertigstellung und Jahre später. Diese kritische Praxis des Wiederbesuchens kam in den Achtzigerjahren in einzelnen Fachzeitschriften auf – etwa in der Rubrik „in die Jahre gekommen“ der Deutschen Bauzeitung. Beim Wiederbesuch werden Gebäude daraufhin abgeklopft, ob sie die anfangs formulierten Ziele erreicht haben. Fotos im Abstand einiger Jahre sagen hier oft mehr als viele Worte.
Ikonen im Dämmerlicht
Dieses Bemühen um Zeitlichkeit, um Erkenntnis von Gebrauchswert, scheint in der Fotografie der glatt glänzenden Neunziger wieder komplett verschwunden. Fachmagazine wie Lifestyle-Gazetten präsentieren Architektur fortan wieder gereinigt und in all ihrer Überinstrumentierung letztlich fad. Im neuen neoliberalen Kalkül jener Jahre wollten Gebäude vor allem vermarktet werden, und als Instrument jenes Marketings diente die Fotografie. Schulen für Fotodesign oder Medienkommunikation schossen wie Pilze aus dem Boden. Deren Absolventen boten Architekturbüros, Agenturen und Redaktionen oft unaufgefordert ihre Foto-Alben feil. Je prächtiger die Architektur in Szene gesetzt, dem Ego ihrer Schöpfer gehuldigt wurde, umso größer die Chancen auf Veröffentlichung. Und Architekten lernten diese Mittel zu nutzen und stellten PR-Leute ein. Wer etwas auf sich hielt, gab eine Werkmonografie heraus.
Das Feuilleton erklärte die Architektur zum kulturellen Leitmedium jener materiell orientierten Jahre. Ikonen aber erfordern Verklärung und Reinigung vom Alltäglichen. Auch darum werden die Werke – oder besser im Immobilien-Sprech: „Objekte“ – meist menschenleer abgebildet. Diese Hochzeit der Architektur-Inszenierung fand ihren Gipfel in der Dämmerungsaufnahme: Gebäude werden hier voll beleuchtet gezeigt, hochtransparent wie im Wettbewerbsrendering, während jedweder Kontext im Zwielicht verblasst. Menschen erscheinen schemenhaft verwischt (wegen der langen Belichtungszeit), Autos hinterlassen skurrile Leuchtspuren. Mögen die auch in den Neunzigern aufgekommenen „Medienfassaden“ bei Tage noch so hermetische Klötze sein – hier glühen sie alle, allein, wunderbar.
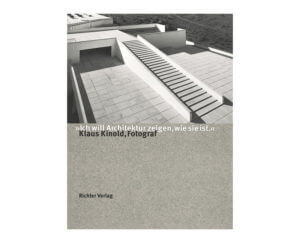
Doch wäre es zu einfach, die Architekturfotografie in nur zwei Lager einzuteilen. So gab und gibt es neben dem beschriebenen „schmutzigen“ Realismus, der Elemente der Reportage-Fotografie aufnahm, auch eine Tradition des menschenleeren, abstrakten Realismus in der Architekturfotografie, der die Gebäude selbst sprechen lässt, sich der Verwertung aber durch ins Extrem getriebene Nüchternheit entzieht. Der kalifornische Künstler Ed Ruscha etwa wäre hier zu nennen; er fotografierte bereits in den Sechzigern die schier endlosen Parkplätze seiner Gegend, um Stadien, Einkaufszentren, frühmorgens, leer – lässt sich ein Lebensstil schlichter entlarven?
Bernd und Hilla Becher dokumentierten ebenfalls seit den Sechzigerjahren in akribischer professioneller Manier die Relikte der Industriekultur. Wassertürme, Kohlezechen, Fördertürme, bei eintönig grauem Himmel fotografiert, reihen sich in ihren Serien zu stummen Zeugen einer Epoche – typologisch, analytisch, anonym.
Schüler der Bechers prägen hierzulande bis heute den dokumentarischen Zweig der Fotografie und entwickeln ihn weiter. Thomas Struth etwa lichtet gern banale Plattenbauten oder menschenleere Straßenszenen ab, hält der Zivilisation scheinbar wahllos einen Spiegel vor. Er experimentierte bei diesen Aufnahmen auch schon mit Nachtsichtgeräten, wie sie das Militär verwendet – und assoziiert damit eine Ausweitung der Kampfzonen dieser Welt in jedermanns Alltag. Kritik wird hier sozusagen subkutan verabreicht.
Die klassische, „repräsentative“ Architekturfotografie, häufig, wie im Falle Kinolds, von ausgebildeten Architekten für Architekten betrieben, versteht sich dagegen weiter als objektiv und neutral. Puristen lehnen tatsächlich bestimmte verzerrende Effekte und Tricks wie die Dämmerungsaufnahme ab. Gleichwohl steckt in völlig menschenleeren Fotos von Gebäuden natürlich eine selbstreferenzielle Botschaft. Wer akribisch jede Spur von Leben in den Bildern tilgt (Photoshop macht es möglich), der abstrahiert, spitzt zu. Etwa Connie Zhou in ihrer aktuellen Dokumentation von Googles Rechenzentren. Sie bekennt sich zu dieser Stilisierung. Viele andere meinen immer noch, sie zeigten „Architektur, wie sie ist“, indem sie wie Kinold „für ein Bezugssystem perspektivischer Linien in der Fläche des Bildes eine plausible Formel finden“.
Recht am Bild: Die Mühen der Praxis
In der Praxis gelingt es Architekturfotografen heute auch beim besten Willen eher selten, Aspekte des Menschlichen, des Gebrauchs, der Zeit in ihre Bilder zu integrieren. Zwar kann und darf heutzutage jeder Gebäude fotografieren, doch die Menschen im Bild müssen vor einer Publikation ihre Einwilligung geben. Da kann es, etwa bei einem zu dokumentierenden Kindergarten, ziemlich schwierig werden, Leben in die Bilder zu bekommen. Und dass gestellte Fotos leicht peinlich wirken, weiß ja jeder.
Der anfangs zitierte Experte Wilfried Dechau sieht das ähnlich: „Solange sich Architekten über Fotos freuen, in denen nichts von ihrer Architektur ablenkt, so lange werden Fotografen das Spiel beglückt mitspielen. Denn es macht dreimal so viel Arbeit, Menschen so ins Bild zu integrieren, dass keiner zu kurz kommt – weder der Mensch noch die Architektur.“ Zudem betonen Architekten inzwischen häufig, wie „nutzungsneutral“ ihre Räume sind – der Kindergarten könnte ja schon bald ein Altenwohnheim werden! Alles in allem gibt es schlussendlich Gründe genug für die langweiligen leeren Architekturfotos. Hinter der Linse lauert also keineswegs immer ein Zwangscharakter.
Seit dem Aufkommen der Digitalfotografie lassen sich Bilder noch aseptischer reinigen und manipulieren als zuvor. Zugleich erschaffen Rechner heute so bestechende fotorealistische Renderings, dass manche schon das Ende der Fotografie heraufziehen sehen.
Doch das dürfte ein Trugschluss sein. Noch verbreiten Webseiten wie dezeen.com, archdaily.com oder baunetz.de die bekannten leeren Bildchen ikonischer Bauten rund um den Globus, ganz in der statischen Manier eines Printmediums. Doch erste Anbieter nutzen die Möglichkeiten des schnellen Internets für mehr: Bei uncube.com gerät die Szene in Bewegung; Filmsequenzen und Interviews vermitteln räumlich komplexere Zusammenhänge und Hintergründe. Und man traut sich hier auch an alltagsnahe Themen wie zuletzt Do-it-yourself, das gerade durch das Netz an Bedeutung gewinnt. Hier sah man viele Menschen.
Sogar in manchem bedrohten Printmedium beginnt beim Buhlen um Aufmerksamkeit ein Umdenken in Richtung Authentizität: Im „Baumeister“ sind auf den ganzseitigen Fotos nun oftmals keine Bauten zu sehen, sondern die Köpfe ihrer Schöpfer. Und im doppelseitigen Aufmacher-Foto „Ein Bild“ wagt man sich zumeist mitten ins Getümmel des „wirklichen Lebens“. Als die Bundesstiftung Baukultur dem Thema „Räume und Menschen“ unlängst einen Fotowettbewerb widmete, erhielt sie 287 Beiträge. Gut möglich also, dass gerade – wieder einmal – subjektivere Zeiten anbrechen in der Architekturfotografie.
Wie Stadtfotograf Rene Wildgrube ganz eigene urbane Erfahrungen in Paris, Mailand und Berlin gesammlt hat, lesen und sehen Sie hier.

