
Nils Hille
Es muss etwas passieren: Würden die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland alle ihre Bauten behalten, müssten sie in ein paar Jahren ihre kompletten Einnahmen für deren Instandhaltung ausgeben. Für das eigentliche Gemeindeleben wäre dann kein Geld mehr da. An vielen Orten stützen sich schon jetzt Bereiche wie Jugendarbeit oder Kirchenmusik nur auf ehrenamtliche Mitarbeiter, denn Stellen einzusparen ist immer noch leichter als Kirchen loszuwerden. Anfang 2006 verkündete das katholische Bistum Essen, dass jede vierte Kirche zur Diskussion steht. Anderswo sieht es nicht viel besser aus. Die evangelische Kirche dementiert dagegen, dass auch sie ein Viertel ihrer Kirchen aufgeben müsste. Sie sieht die notwendigen Einnahmen eher im Verkauf ihrer anderen Gebäude.
Seit der schlechten Botschaft aus Essen wird vielerorts intensiv über das Thema diskutiert. In Köln trifft sich seit zwei Jahren der Verein „Architektur Forum Rheinland“ jeden Monat zu diesem Thema. Geschäftsführer Jörg Beste hat einen kühnen Vergleich: „Was die Fabrikareale in den 80er- und 90er-Jahren als Bauaufgabe mit Lernbedarf waren, sind die Kirchen heute. Hierfür fehlen uns vielfach noch die Erfahrungen.“ Was ist an Bestand da und wie kann man diesen sichern? Stadtplaner, Architekten und Kirchenvertreter versuchen hier gemeinsam, Antworten zu finden – und auch die Bürger diskutieren intensiv mit, sagt Beste: „Wir haben ein erstaunlich großes Interesse gespürt. Viele Leute kamen auch von weit her, was uns gefreut hat, aber auch die Größe des Problems zeigt.“

Genau das ist der Punkt
Die Menschen spüren, dass schnell auch ihre Kirche zur Diskussion stehen kann. Die, in der man getauft und getraut wurde – und die, in deren Gemeinde man eigentlich auch beerdigt werden wollte. Die, die mitten im Dorf oder Stadtteil steht. Die, die einfach zum gewohnten Umfeld dazugehört. Beste: „Kirchen sind der Landeskern. Der Städtebau orientiert sich an ihnen. Sie haben immer ein besonderes Grundstück bekommen, die Straßenführung richtet sich nach ihnen als Stadtkrone. Und die Kirche steht auch als Symbol dafür, dass sich jemand um die Menschen eines Ortes kümmert. Vor allem in schwierigen Situationen finden sie hier Zuflucht.“ Wer gibt so einen Ort schon freiwillig auf? Wird die finanziell schwierige Situation einer Gemeinde publik, reagieren nicht nur deren Mitglieder mit Entsetzen. Auch die Kirchenfremden wollen ihre Kirche im Dorf lassen. Gerade hierhinter verbirgt sich eine große Chance, sagt Beste: „Neben viel Ratlosigkeit und Frustration war bei unseren Veranstaltungen auch Aufbruch zu spüren. Wenn eine Gemeinde frühzeitig bekannt gibt, dass eine Kirche bedroht ist, entsteht viel Zuspruch zur Rettung und Aktivität von außen.“ Doch auch bei einer großzügigen Unterstützung von Kirchenfremden wird oft nicht so viel Geld aufgebracht werden, dass alle Kirchen ihre Funktion behalten.
Was darf aus einer Kirche werden? Ein Beispiel wie die St.-Raphael- Kirche von Rudolf Schwarz in Berlin-Gatow, die erst zum Supermarkt umgenutzt werden sollte und dann kurz vor der Einstufung als Baudenkmal abgerissen wurde, möchte niemand erneut erleben. Die evangelischen Landeskirchen und katholische Bistümer haben dafür in den letzten Jahren Leitlinien formuliert. Danach geht Umnutzung vor Verkauf, eine verträgliche, kirchennahe Fremdnutzung vor eine wirtschaftliche – aber auch Abriss vor Imageschaden. Die Lösung muss für jede Kirche individuell ermittelt werden. Für ihren Erhalt empfiehlt Jörg Beste: „Die Schwelle muss niedriger gesetzt werden. Wird sie auch weltlich genutzt, zum Beispiel als Café, dann erübrigt sich vielleicht die Abrissfrage.“

Hier sind Architekten gefragt
Zum Beispiel Bernhard Busch, geschäftsführender Gesellschafter des Büros agn Niederberghaus und Partner in Ibbenbüren. Er hat die Bonifatiuskirche in Münster in ein Verlagshaus verwandelt. Über einen Wettbewerb kam das Büro an den Auftrag. Der zukünftige Betreiber gab ein stringentes Raumprogramm vor, auch das Baukostenbudget war klar definiert: Die Umnutzung durfte nicht mehr Geld kosten als ein Neubau. Busch: „Das führte dazu, dass wir in der Ausstattung knappe Ressourcen hatten. Die Lüftungsschächte und der alte Heizkessel wurden zum Beispiel weitergenutzt.“
Ideen mussten vor allem für die Beheizung und Belichtung her. So wird die warme Luft oben in dem hohen Raum abgesaugt und unten wieder zugeführt. Von den Mosaikfenstern sind nur ein großes und wenige kleine im ehemaligen Altarraum geblieben. Alle anderen Rahmen halten nun Klarglas. Zusätzlich wich der Vorraum des ehemaligen Eingangsbereichs einer Glasfassade. Die östliche Kirchenwand wurde aufgerissen und mit großzügigen Fenstern über zwei Etagen ausgestattet.

Trotz der teils massiven Veränderungen kann der Besucher auch heute im Inneren deutlich erkennen, dass dieses Gebäude eine Kirche war. Denn nicht alle Bereiche haben ihr ursprüngliches Gesicht verloren. Der Altarbereich ist in seiner offenen Gestaltung geblieben. „Hier hätten wir uns keine Einbauten wie Konferenzräume vorstellen können“, erklärt Busch. Als Ersatz dafür erhielt der Anbau eine Aufstockung, die einem gläsernen Sitzungssaal Platz bietet. Außerdem fördert die Konstruktion der Büros und weiterer Konferenzräume über drei Etagen, die abgelöst von den Außenwänden in die Mitte platziert wurden, diesen bewahrenden Eindruck. Busch: „Neue Materialien für eine neue Konstruktion machen deutlich, was hier hineingestellt wurde.“ „Hineingestellt“ hat Busch ganz gezielt als Begriff verwendet, denn „unter Umständen könnte das Verlagshaus wieder zur Kirche zurückgebaut werden. Dies war keine Vorgabe, aber ein emotionaler Gedanke, den der Bauherr deutlich gemacht hat.“
Emotional wichtig war für viele Gemeindemitglieder auch der direkte Kontakt zum Architekten Busch, nachdem die Entscheidung zum Verkauf getroffen wurde. Er ließ sie am Umbauprozess teilhaben: „Wir hatten oft ehemalige Gottesdienstbesucher auf der Baustelle. Sie wollten erfahren, was aus ihrer Kirche wird. Die meisten konnten sich dann später mit der Entscheidung zur neuen Nutzung identifizieren oder zumindest positiver damit umgehen.“ Viel Einfühlungsvermögen gehört also dazu. Dies sieht Jörg Beste vom Architekturforum auch so: „Beim Umbau einer Kirche arbeitet man immer mit einem Auftraggeber, der sich in einer schwierigen Situation befindet. Da gehört in manchen Gemeinden sogar eine psychologische Betreuung mit dazu. Der Architekt bewegt sich immer auf dem Präsentierteller und muss ständig mit Widerständen rechnen.“ In Münster gehört der Kirchturm, der getrennt von dem Verlagsgebäude steht, immer noch der Gemeinde. Auch so ein Kompromiss kann ein wichtiges Zeichen setzen. Der Turm steht nun als Symbol für eine weiterhin existierende, lebendige Gemeinde.

Zu weit gegangen?
Wenn ein kirchliches Symbol für kommerzielle Zwecke genutzt werden soll, sind die Diskussionen vorprogrammiert. Architekt Heinrich Martin Bruns, der den wohl bekanntesten Kirchenumbau gesteuert hat, bewegt sich nah an der Grenze zwischen den Möglichkeiten und der Empfindlichkeit. Die Bielefelder Martinikirche wurde durch ihn zum Restaurant „Glück und Seligkeit“. Bei vielen stößt schon der Name negativ auf, wie beim Kölner Beste: „Eine hochwertige Gastronomie ist in Ordnung, aber der Name ist peinlich, denn er spielt mit einer Stammtischmentalität.“ Auch Architekt Busch sieht Probleme: „Der Umbau der Bielefelder Kirche zum Restaurant ist grenzwertig, da die sakrale Ausprägung des Raums weiterhin sehr deutlich ist.“ Bruns erklärt in Interviews, er habe nun vor, den Turm in seiner ursprünglichen Höhe von 42 Metern wiederherzustellen. In den 80er-Jahren war er aus statischen Gründen auf 20 Meter zurückgebaut worden. Ein leichtes Stahlgerüst soll nun die Umrisse des ursprünglichen Bauwerks nachzeichnen. Beste sieht in dieser Idee die Grenze überschritten: „Ich frage mich: Worauf soll dieser dann hinweisen? Auf Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch? Da wird mit der Corporate Identity der Kirche gespielt, was kulturell nicht nachvollziehbar ist.“ Busch betont den Unterschied zwischen architektonisch Machbarem und gesellschaftlich Gewünschtem: „Auch wenn wir uns eine Diskothek oder Kneipe aus rein architektonischer Sicht gut vorstellen könnten, sind solche Formen hier nicht gefragt. Wird mit der Umnutzung gesellschaftlich der Wert angehoben, gibt es Beifall. Sinkt er, gibt es Schläge.“
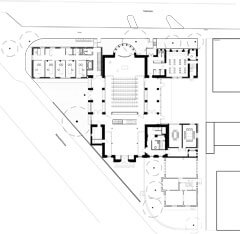
So finden Umbauten zur kulturellen und sozialen Nutzung den größten Konsens. Im Bistum Essen ist Architekt Franz-Josef Gierse dadurch zum Pionier des Kirchenumbaus geworden. In der schwierigen Lage sah der heute 78-Jährige eine architektonische Herausforderung. Zahlreiche Kirchen hat er in seinen 45 Jahren Selbstständigkeit gebaut, jetzt wollte er herausfinden, wie man sie umnutzen kann. Seine einfühlsamen Ideen stießen auf Begeisterung; zwischenzeitlich war er mit dem Umbau von gleich drei Kirchen parallel beschäftigt. Zwei davon sind nun fertig.
So wurde die Kirche St. Peter in der Nordstadt von Essen in eine Schule für Pflegeberufe verwandelt. Gierse: „Sie ist 1926 mit einem Touch Bauhausstil entstanden. Nach der Zerstörung im Krieg wurde sie wiederaufgebaut, woran ich beteiligt war. Nun habe ich den Tempel zur Umnutzung wieder getroffen.“ Vom Denkmalschutz ließ sich Gierse nicht abschrecken. Da er die Geschichte der Kirche bestens kannte, fragte er, ob der rekonstruierte Bau wirklich unantastbar sei. So konnten unter anderem die Lichtschlitze bedenkenlos erweitert werden. Auch die Lage schien problematisch, denn die Kirche steht in einem reinen Wohngebiet. Nun kommen 450 Schüler tagsüber dazu. Am 11. November fand die Einweihung von Gierses zweitem Umbau statt. Die Kirche St. Martin in Essen-Rüttenscheid aus dem Jahre 1956 ist nun ein Pflegeheim der Caritas für 100 Bewohner – inklusive eines großen Andachtsraums.
Neues Arbeitsfeld für Architekten?
Gierse sieht ein großes Spektrum an neuen Nutzungsmöglichkeiten für Kirchen. Wenn er von der Suche nach einem Gebäude hört, fragt er gleich, ob es nicht ein Gotteshaus sein könnte. Er bringt auch immer selbst Ideen hervor. Seine neuste: Da die Instrumentalmusik in NRW mehr gefördert werden soll, könnte er sich als nächstes Projekt vorstellen, eine Kirche zur „Casa Musica“ umzubauen, mit vielen Übungsräumen und einem großen Vorführsaal.
Beste sieht in der Situation eine Chance für Architekten: „Es wird eine wichtige Bauaufgabe sein, über die sich der Architekt profilieren kann. Doch für die komplexe Aufgabe einer Kirchenumnutzung müssen adäquate Lösungen gefunden werden.“ Dass man mit diesen Ideen das große Geld verdienen kann, bezweifelt Architekt Busch: „Viele Veränderungen und Umnutzungen von kirchlichen Gebäuden stehen in den nächsten Jahren an. Hier werden eindeutig Architekten gebraucht. Dass es aber zu einem großen Tätigkeitsfeld wird, glaube ich nicht, denn wirtschaftlich gesehen ist es wenig reizvoll, da die Arbeit sehr individuell und nicht übertragbar auf eine Serienumstellung ist. Jeder neue Auftrag ist ganz anders anzugehen. Mit einem kleinen Vorteil durch die gesammelten Erfahrungen.“

Der Essener Architekt Gierse hat trotzdem Freude an dem Thema gefunden. Bei seinem aktuellen Projekt, der Umnutzung einer Essener Kirche zu Wohnungen, brachte er gleich drei verschiedene Konzepte in die Gemeinde: „Ein Mitglied sagte zu mir: ‚Ich habe geglaubt, dass unsere Kirche abgerissen wird. Jetzt, durch Ihre Ideen, besteht wieder Hoffnung, dass das Gebäude doch erhalten bleibt.‘ “ Für den Architekten ist eines klar: Man muss das Thema angehen und nicht verschweigen. „Unser Bischof hat dies gut gemacht, da er das Problem in die Öffentlichkeit gebracht hat. Mit dieser Art hat er der Mentalität der Menschen aus dem Ruhrgebiet entsprochen.“
Neben einer größeren Offenheit
wünschen sich viele vor allem ein strukturiertes Vorgehen der Kirchen. Beste: „Ob Kirchen erhalten oder abgerissen werden, darf nicht dem Zufall überlassen bleiben. Für eine rationale Entscheidung ist eine unabhängige Gebäudebewertung mit Beachtung des Ortes und dessen Struktur, eine technische sowie eine baukulturelle Bewertung erforderlich. Und eine Moderationshilfestellung von außen. Gemeinden, die schrumpfen, sind anfällig für selbstzerfleischende Prozesse.“
Um in einen offenen Dialog zu treten, müssen Architekten und Gemeinden auch Vertrauen zueinander gewinnen. Beste: „Es ist oft schwierig, mit Amtskirchen zu sprechen. Hier geht der Abriss vor einer, aus ihrer Sicht, imageschädigenden Fremdnutzung. Dass die französische Armee den Kölner Dom als Pferdestall genutzt hat, sollte man sich dabei einmal wieder in Erinnerung rufen. Es muss sich ja zukünftig nicht das goldene Imbissketten-M auf dem Dach drehen.
Alle an einem Tisch
AKUT, der Arbeitskreis Kirchenumnutzung im Tal, hilft Wuppertaler Gemeinden in schwieriger wirtschaftlicher Lage. Ein Kooperationsmodell, das Schule machen könnte. Es ist ein Pilotprojekt. In Wuppertal treffen Architekten, Vertreter der christlichen Kirchen, der Universität und der Stadt momentan regelmäßig zusammen. Als AKUT bieten sie Gemeinden, die sich von Gebäuden trennen müssen, ein kompaktes, ehrenamtliches Hilfsangebot. Die Anzahl der Bewerbungen waren so groß, dass für die Pilotphase nur ein Teil ausgewählt werden konnte, sagt Ingo Sauer von der Stadt Wuppertal: „In den zwei Gemeinden, die wir ausgewählt haben, gibt es mehrere Gotteshäuser. Somit war unser erstes Ziel, Kriterien für eine spätere Empfehlung zu definieren, welche Kirchen bleiben und welche nicht. Jeder aus seinem Fachbereich macht sich dazu Gedanken. Diese gilt es dann zu verknüpfen.“ Pfarrerin Ilka Federschmidt: „Viele Aspekte fließen in unsere Bewertung mit ein: Der Sozialraum, in dem die Kirche steht, die Topografie, die Anzahl der Gemeindemitglieder und deren Aktivitäten in dem Gebäude bis hin zur Wirtschaftlichkeit.“ Am Ende kann der Gemeinde auch mehr als eine Empfehlung gegeben werden, wenn der Arbeitskreis sich keine einheitliche Meinung bilden konnte.
Auftrag und Ausbildung
Bei Interesse vermitteln die Experten passende Leistungspartner an die Gemeinden. Auch die Architekten von AKUT können dadurch direkt Aufträge bekommen, da sie ihr Fachwissen und Engagement schon bewiesen haben. Mit der ehrenamtlichen Arbeit ist noch ein weiteres Interesse verbunden, erklärt Federschmidt: „Unsere Erkenntnisse liefern Materialien für einen verzahnten Studiengang.“ Die Universität Wuppertal will einen interdisziplinären Master „Kirchenbau und Denkmalpflege“ einrichten, wenn sie genug Bedarf an Architekten mit diesem Fachwissen sieht. Das Angebot wäre bundesweit einmalig, frühestens 2009 könnte die Ausbildung starten.
Buchtipps
Jessica Wehdorn
Kirchenbauten profan genutzt
Umnutzungen von Sakralräumen waren nicht immer von Respekt geprägt. Die vorhandene Gebäudehülle sollte einfach weiterverwendet werden; so entstanden daraus Lagerhäuser, Justizanstalten und Geschäfte. Rund 70 profan genutzte Kirchen in Österreich stellt Architektin Jessica Wehdorn vor. Sie zeigt dabei auch die Chance auf, diese Räume wieder erlebbar zu machen.
39,90 Euro, 260 Seiten, Studienverlag

Gottes neue Häuser
Trotz der finanziell schwierigen Lage ist Kirchenneubau auch heute noch ein Thema. Zwanzig aktuelle Beispiele geben einen guten Einblick in dieses kleine, aber nicht völlig ausgestorbene Kapitel der Architektur.
29,90 Euro, 114 Seiten, edition chrismon


