
Text: Cornelia Dörries
Auch wenn es manchmal anders scheint: Farblosigkeit gibt es nicht. Oder wie Thomas Schmitz sagt: „Der Mensch nimmt alle Oberflächen als Farbe wahr. Und alles, was gebaut wird, hat eine Farbe.“ Schmitz, Jahrgang 1956, ist Architekt und beschäftigt sich als Professor für bildnerische Gestaltung an der RWTH Aachen mit der Wirkung von Farbe in Architektur und Städtebau. Dabei geht es ihm weniger um spezifisch gestalterische Aspekte oder Fragen nach dem passenden Kolorit für bestimmte Typologien. Ihn beschäftigt vielmehr der konstitutive Zusammenhang von Farbe und Form in der Architektur. Anders formuliert: Für Schmitz gehört Farbe zu jenen Faktoren, die für die Qualität von Architektur maßgeblich sind. „Natürlich kann man einen Raum rational als geometrisches Phänomen über Konstruktion und Funktion erfassen“, erläutert er. „Doch Raum ist immer auch Wirkung, und zwar über seine Primäreigenschaften Proportion, Licht, Farbe und Klang.“
Dass die Farbigkeit von Räumen und Orten Einfluss auf die Befindlichkeit des Menschen hat, ist freilich keine neue Erkenntnis. Schon Goethe beschäftigte sich in seiner Farbenlehre von 1810 mit „der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farbe“; seine umfassende Klassifizierung gilt bis heute als Grundlage moderner Farbtheorien. Thomas Schmitz möchte einen ähnlich systematischen Zugriff auf das Phänomen Farbe zum Bestandteil der Architektenausbildung machen – erweitert um die gegenwärtigen technischen und digitalisierten Möglichkeiten der Farbgebung sowie neue Erkenntnisse aus Psychologie und Neurowissenschaft. Denn Architekten, so seine Überzeugung, müssen nicht nur in technischen und logistischen Dimensionen, sondern auch in Farbe und Materialität denken und entwerfen können.
Beherrschung der Vielfalt

Der Umgang mit Farbe in der Architektur beschränkt sich jedoch nicht auf die Gestaltung von Innenräumen oder Wandanstrichen. So plädiert der Architekt und Philosoph Axel Buether für den Respekt vor dem, was man als farbliche Identität eines Ortes bezeichnen könnte. Sie ist der Zusammenhang zwischen den natürlichen Gegebenheiten wie der Wolken- und Dunstbildung sowie der sich daraus ergebenden Farbe des Himmels, der Farbigkeit der vorherrschenden Vegetation und den Farben der Gebäude. Die historisch gewachsene farbliche Identität eines Ortes erläutert der Architekt und Wahrnehmungspsychologe Ralf Weber von der TU Dresden so: „Ursprünglich wurde die farbliche Erscheinung der Architektur durch die Auswahl der verwendeten Materialien bestimmt. Der kompositorische und stilistische Rahmen war durch die jeweils regional verfügbare Auswahl von Materialien beschränkt. Auf dieser Basis entwickelten sich regionale und stilistische Bautraditionen, die neben den verwendeten Bauformen und Ornamenten durch ihre Materialität und Farbigkeit identifiziert werden konnten. Ausnahmen bildeten Sonderbauten wie Paläste, bei denen Außen- und Innenwände zu dekorativen Flächen mutierten, die nach Gestaltungsprinzipien aus den damals dominierenden Kunstformen gestaltet und verziert wurden.“ Für diese repräsentativen Bauten wurden dann auch die damals noch sehr raren und teuren Farbpigmente verwendet, sodass über die differenzierte Farbigkeit der verschiedenen Architekturen auch eine Hierarchisierung ablesbar war.
Vor diesem Hintergrund entwickelte sich zunächst keine eigene Farbenlehre für die Baukunst. Ralf Weber erläutert: „Erst als sich Architektur mehr und mehr zum entmaterialisierten Canvas entwickelte, bei dem Farbe unabhängig vom Trägermaterial aufgebracht werden konnte, verbreiteten sich ab dem 17. Jahrhundert in Europa erste, nur auf die Architektur bezogene Farbenlehren in Gestalt von Musterbüchern und Lehrbüchern für Baumeistern.“ Diese Kompendien spiegelten nicht zuletzt das Bestreben wider, den Umgang mit Farbe in der Architektur auf eine systematische Grundlage zu stellen und Gebäude über Farbgebung und Ausgestaltung gewissermaßen zu bekleiden.

Mit der zunehmend industrialisierten Produktion von Farben und modernen Verarbeitungsmethoden löste sich die traditionelle Bindung von Farbe und Material in der Architektur weitgehend auf. Auch die altvorderen Farblehren wurden von abstrakten, theoretisch begründeten Farbkompositionsprinzipien ersetzt, die nicht zuletzt von der sich vollziehenden Annäherung von Architektur und bildender Kunst inspiriert wurde. Einen radikalen Bruch bewirkte die Moderne, in der beispielsweise Siegfried Giedion alle nicht-konstruktiven architektonischen Gestaltungsmittel – mithin auch Farbe – als „dekorativen Schleim“ disqualifizierte. „Diese Architektur wurde zur weißen Moderne, in der reine stereometrische Formen dominierten“, so Weber. „Sie waren von Farb- und Textureigenschaften des verwendeten Materials völlig unabhängig. Beispiele dafür wären die Weißenhofsiedlung und die Dessauer Meisterhäuser oder die reinweißen Projekte, für die in den USA die Gruppe der New York Five um Peter Eisenman steht.“
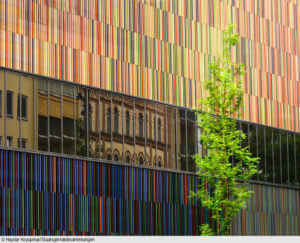
Doch auch die farbenthaltsame, kühle Moderne kannte alternative Entwicklungen. Nicht nur die Backsteinbauten von Fritz Schumacher in Hamburg oder Frank Lloyd Wrights Meisterschaft bei der Integration von Material, Form und Farbe belegen die fortlaufende Auseinandersetzung mit Kolorit in der modernen Architektur.
Welche Farbvielfalt gerade die frühe Moderne wagte, blieb lange unter dem praktischen grauen Kratzputz der Nachkriegszeit verborgen. Es ist das Verdienst des Berliner Architekten Winfried Brenne, dass die fröhliche Buntheit eines Bruno Taut nicht nur in das bauhistorische Bewusstsein zurückkehrte, sondern auch viele seine Bauten wieder strahlen lässt. „Wir hatten einen ganz unbedarften Zugang zu diesem Thema“, erinnert sich Brenne. „Als wir 1976 mit der Sanierung der Siedlung ‚Onkel Toms Hütte‘ in Berlin begannen, haben wir uns gefragt, ob Taut seinerzeit wirklich grauen Kratzputz im Sinn hatte.“ Erst das Studium der Bauakten brachte zum Vorschein, dass Taut seine schlichten Wohnhäuser nach einem komplexen Farbkonzept gestaltet hatte, das dazu diente, jedes Element der sparsamen Architektur zur Geltung zu bringen und die Gebäude in eine Beziehung zur umgebenden Natur zu setzen. Er war sogar so weit gegangen, ein Haus entlang der Straßenseite grün zu streichen, seine Rückseite ganz blau zu färben und beides durch weiße Balkone gewissermaßen zu vernähen. Winfried Brenne muss auch heute noch über Tauts Kühnheit lachen. Ein Haus mit einer blauen und einer grünen Front: Ist das nicht verrückt? Nein, wunderschön. Denn blaugrün schimmern auch die Nadeln der Kiefern ringsum. „Doch die Farbe diente bei Tauts Bauten nicht allein der Dekoration“, so Brenne. „Der Anstrich hatte auch eine bauphysikalische Funktion. Taut verwendete nämlich Mineralfarben, die sich wie bei einem Fresko dank ihres quarzhaltigen Bindemittels mit dem Untergrund verbinden konnten.“ Dazu kommt, dass die von Taut verwendeten mineralischen, erdpigmenthaltigen Farben nicht „rein“ sind, sondern unter dem Mikroskop in allen Farben des Spektrums schillern. Sie können das Sonnenlicht und Tagesstimmungen deshalb viel lebendiger reflektieren und lassen die Häuser auf gewisse Art zu einem Teil ihrer Umgebung werden.
Farben und Epochen

Doch gibt es in der Architektur wie in der Mode auch klar abgrenzbare Farb-Trends? Matthias Grüne, Architekt und Professor an der Hochschule Esslingen, hat für die deutsche Nachkriegsarchitektur differenzierte Farbepochen ermittelt, in denen bestimmte Töne und Schemata dominierten. Waren die kargen Wiederaufbaujahre fast zwangsläufig von traditioneller Handwerkstechnik geprägt, die sich auf den Einsatz von ans Material gebundener Farbe beschränkte, setzte sich die Architektur der sozialen Wohnungsbauprogramme der 1960er-Jahre aufgrund der neuen Produktionstechnologien und Materialien – Stichwort: Waschbeton – mit einer unbunten Ästhetik davon ab: das berüchtigte Grau der Funktionalität konnte sich auch durch die schiere Masse der damals entstehenden Bauten als dominierender Farbton durchsetzen. Dem setzte das wenige Jahre später anbrechende Pop-Zeitalter mit einem wahren Farbrausch ein Ende. Das farbige Design von Otl Aicher für die Olympischen Spiele 1972 war nur der Anfang der neuen Buntheit, die mit braunen, erdigen Tönen, Orange, Olivgrün und Curry zugleich eine warme, geborgene Heimeligkeit vermittelte. Die Postmoderne der 1980er-Jahre mischte diese selbstzufriedene Gemütlichkeit mit einem kühlen Kontrastprogramm aus künstlichen, kräftigen Farben auf, und auch die 1990er-Jahre erteilten jedem Anflug von Sentimentalität mit dem damals beliebten Blau sowie Glas, Sichtbeton, Stahl und spitzen Winkeln eine Abfuhr. Erst das junge 21. Jahrhundert fand zur reinen, klaren Form, zu warmen Weißtönen und einer vorzugsweise natürlichen, im jeweiligen Material gebundenen Farbigkeit zurück. Die Karriere eines Baustoffs wie Lärchenholz steht geradezu musterhaft dafür. Eine Renaissance erlebten auch moderne Farbschemata beispielsweise von Le Corbusier, die im Zuge der Sanierung und Restaurierung von Bauten dieser Generation wiederentdeckt wurden.
Doch gerade weil es keine Architektur ohne Farbe gibt und die Vielfalt der damit verbundenen gestalterischen Möglichkeiten nie größer war, wundert es fast, dass der systematische und wissenschaftlich fundierte Umgang mit diesem gestalterischen Mittel noch kein verbindlicher Teil der Architektenausbildung ist. Denn Rot ist nicht gleich Rot.
War dieser Artikel hilfreich?
Weitere Artikel zu:

